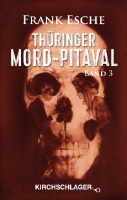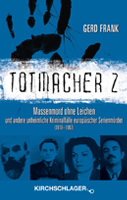Wir führen Dich, freundlicher Leser, in ein Haus in der Wiener Leopoldstadt, welches Eigentum des Bürgers Georg Niener war. Im zweiten Stockwerk des Hauses, in einem lichten, wohnlich eingerichteten Zimmer, saßen zwei junge Mädchen, emsig mit Näharbeit beschäftigt, und die Menge von feiner, zierlich aufeinander geschichteter Damenwäsche, von Tischtüchern, Servietten, kurz von allem dem, was man jungen Eheleuten zum Beginn ihrer neuen Wirtschaft mitzugeben pflegt, ließen den aufmerksamen Beobachter erkennen, daß hier noch die letzte Hand an die reiche, solide Aussteuer einer Wiener Bürgerstochter gelegt wurde. Eine ganz erkleckliche Anzahl neuer Kleider, worunter eines von weißer Seide, mit gleichfarbigen Maschen und Spitzen geziert, und ein langer, spinnengewebähnlicher Brautschleier, die sorgfältig an einem Kleiderstock aufgehängt waren, bestärkten diese Meinung noch. Glitt aber der Blick von all diesen Herrlichkeiten auf die beiden Mädchen, so würde man wieder irre, denn still, fast traurig saßen die beiden da, und nur das Rauschen des Stoffes, an dem sie ihre Kunstfertigkeit erprobten, unterbrach von Zeit zu Zeit die fast unheimliche Ruhe.
Wenden wir uns nun zu den fleißigen Arbeiterinnen. Die Ältere, ein Mädchen von neunzehn bis 20 Jahren, mit blassen, freundlichen Gesichtszügen, umrahmt von einer reichen Fülle blonder Locken, mit blauen, sinnenden Augen, aus welchen, wir wollen nicht sagen ein Ausdruck tiefen Leides, doch unstreitig der einer stillen Resignation leuchtete, nannte sich Thekla und war die Tochter des Hausherrn Georg Niener. Sie war die Braut, der diese Menge von Dingen, die ein weibliches Herz zu erfreuen vermögen, bestimmt war. Doch, wie gesagt, sie schien nicht sonderlich erbaut davon, denn wenn je ein Blick über all die Sachen hinstreifte, so bekundete er Unwillen und Trostlosigkeit, nicht aber die Seligkeit, das stille Glück und heimliche Zagen einer glücklichen Braut.
Ihre Gesellschafterin, die ein bis zwei Jahre weniger zählen mochte, war ein schwarzäugiges, dunkelgelocktes munteres Mädchen, dem das ewige Stillschweigen unangenehm genug war. Sie rückte ungeduldig auf ihrem Stuhl hin und her, öffnete wiederholt das rosige Mündchen zum Sprechen, doch so wie ihr Blick die arme, in stummer Trauer fortarbeitende Freundin traf, unterdrückte sie die Worte, die auf ihren Lippen schwebten. Endlich wurde es ihr doch zu viel, sie sprang auf, warf die Arbeit auf den nebenstehenden Tisch, eilte auf Thekla, die verwundert aufblickte, zu, und rief, den Hals ihrer Freundin umschlingend, mit herzlicher, bittender Stimme: „Thekla, meine liebe, gute Thekla, sei doch nicht immer gar so traurig! Ich bitte Dich!“
Thekla erwiderte die Liebkosungen der Freundin und antwortete mit wehmütigem Lächeln: „Du bist ein Kind, Rosinchen, und glücklich, daß man Dich nicht zu einer verhaßten Verbindung zwingt.“
„Kannst Du Dich denn gar nicht mit dem Gedanken versöhnen, diesem Manne anzugehören?“
„Ich werde es wohl müssen, denn mir bleibt kein Ausweg.“
„Aber höre nur: Er ist freilich bedeutend älter als Du, aber endlich doch, so wie man sagt, ein Mann in den schönsten Jahren. Seine äußere Erscheinung, je nun, ich verstehe mich doch auch etwas darauf, ist gar so übel nicht. Er ist stets mit ausgesuchter Eleganz gekleidet, ich sah ihn Dir gegenüber nie anders, als voll Rücksicht, Hochachtung und Liebenswürdigkeit, und daß er alles aufbot Deine Neigung zu erringen, daß er jeden Wunsch Deines Herzens zu erfüllen suchte, ehe Du ihn noch ausgesprochen, das mußt Du selbst eingestehen. Sieh nur einmal das herrliche Brautkleid, diesen prachtvollen Schleier. Also was hast Du gegen ihn?“
„Sieh, Mädchen, ich erkenne daraus, wie ganz anders man einen Menschen betrachtet, wenn dies mit gleichgültigen Augen geschieht. Ich aber, die ich von dem Augenblick an, wo ich seine Absichten erriet, ihn, wenn auch mit furchterfülltem Herzen, doch glaube mir, darum nicht minder genau und scharf beobachtet habe, ich kenne ihn besser. Er hat einen falschen, boshaften Zug im Gesicht, der mich erschreckt und seine Augen, die er wohlweislich hinter dunklen Gläsern verbirgt, die ich aber durch Zufall einmal ohne diese zu sehen bekam, verraten so viel Grausamkeit und Härte, daß bei dem bloßen Gedanken daran ein eisiger Schauer mich bis ins Innerste erbeben macht. Und das ist es, was mir so viel Abscheu einflößt vor dem Mann. Trotz seiner Beteuerungen, wie unendlich er mich liebe, wie glücklich er mich machen wolle, sehe ich nur mit Zittern einer Zukunft entgegen, die mich zwingt, ihm anzugehören!“
Das arme Kind brach bei diesen Worten in Tränen aus. Rosine, ihre Liebkosungen verdoppelnd, selbst Tränen in den Augen, stampfte unwillig mit dem Füßchen und rief ein über das andere Mal: „Ei, so heirate ihn nicht! Heirate ihn nicht!“
„Ach, wenn das ginge“, fuhr Thekla, die Augen trocknend, fort, „aber es ist umsonst. Ich habe kein Geheimnis vor Dir, Rosinchen, keines. Dies Haus ist nur mehr dem Namen nach Eigentum meines Vaters, sein Wohlstand ein eingebildeter. Unglückliche Unternehmungen haben das Vermögen meiner Eltern verschlungen und mein künftiger Mann besitzt ein großes schönes Haus mit Garten hier in der Leopoldstadt und noch überdies ein beträchtliches Vermögen. Er versprach meinen Vater nicht nur vor dem drohenden Elend und vor Schande zu retten, sobald ich ihm meine Hand reichte, er verpflichtete sich auch, den alten Wohlstand wieder herzustellen. Mein Vater ließ mir die Wahl. Das heißt, er sagte mir: Wenn Du es zugibst, daß Deine Eltern in Schande und Spott verkümmern müssen, so bist Du ein schlechtes Kind und, ich, ich fluche Dir!“
Reichlicher flossen Theklas Tränen und auch das muntere Rosinchen weinte jetzt ganz ernstlich: „Arme Thekla“, flüsterte sie, „mein armes, liebes Mädchen!“
Ein tiefer Seufzer aus Theklas Brust beantwortete diese Bemerkung der Freundin.
„Liebes Rosinchen, reden wir lieber gar nicht mehr davon!“
Mit diesen Worten nahm Thekla ihre Arbeit auf. Rosine folgte ihrem Beispiel und dieselbe Stille, dieselbe unheimliche Ruhe herrschte wieder in dem Zimmer. Die Mädchen nähten schweigend fort. Nur dann und wann erhob sich Rosinens Köpfchen, und ihr Blick glitt trauernd und wehmütig über das blasse, leidende Antlitz ihrer Freundin.
Weder Theklas Tränen, noch ihre Abneigung gegen den ihr bestimmten Begleiter durch das Leben, brachen den starren Sinn ihrer Eltern und am 15. August 1794 führte der Kriminalgerichtsassessor Anton Grünborn die Wiener Bürgerstochter Thekla Niener zum Altar.
Fast unmittelbar nach dem Hochzeitstag, der trotz der zahlreichen Gäste und all des Aufwandes, den Grünborn veranstaltete oder vielmehr durch Niener veranstalten ließ, ziemlich traurig ausfiel, zeigte sich der neue Ehemann in seinem wahren Licht. Wir wollen statt aller anderen weitläufigen Schilderungen dem Leser eine Szene vor Augen führen, die sich wenige Tage nach der Hochzeit in Grünborns Haus ereignete.
Es ging auf drei Uhr. Die junge Frau saß blaß und trübselig in einem Armstuhl, an einem in den Garten führenden Fenster, die Arbeit ruhte in ihrem Schoß, und die Hände über derselben gefaltet, blickte sie trüb sinnend vor sich hin.
Rasche Schritte im Vorhaus erweckten sie aus ihren Träumen. Fast ängstlich blickte sie zur Tür, die rasch aufgestoßen wurde. Auf der Schwelle erschien Herr Anton Grünborn, Kriminalgerichtsassessor, eine hohe, etwas eckige Gestalt, deren Antlitz der von Thekla ausgesprochenen Schilderung vollkommen entsprach, welches, obwohl dem flüchtigen Beobachter eben nicht unschön erscheinend, dem aufmerksamen auf den ersten Anblick Widerwillen, ja Abscheu einflößte.
Grünborn warf die Tür unsanft hinter sich zu und den Willkommensgruß Theklas nicht beachtend, rief er ihr, Hut und Stock auf einen Tisch schleudernd, mit barscher, mißtönender Stimme zu: „Schon wieder am Fenster? Was habt Ihr Weiber ewig und immer dort zu tun?“
„Es führt ja nur in den Garten“, erwiderte Thekla, „der von keiner lebenden Seele besucht wird.“
„Papperlapapp, mir macht man nichts weiß. Ich will es einmal nicht. Ich hasse dieses Hinunter- und Heraufgucken, das gewöhnlich damit endet, daß man seinen Herrn Gemahl zum gehörnten Siegfried macht. War jemand hier?“
Die arme Frau, die sich bei den rohen Worten Grünborns vom Fenster entfernt hatte und mit Mühe ihre Tränen zurückhielt, antwortete mit leiser Stimme: „Meine Mutter.“
„Oho, schon wieder die Frau Mama. Die sucht ihr liebes Töchterlein oft heim. Was wollte sie hier?“
„Nichts, als ihr unglückliches Kind besuchen!“
„Die alten Faxen, das greift bei mir nicht an. Sie hat Dir etwas gebracht?“
„Nein.“
„Ja und tausendmal ja, ich weiß es! O, diese alten Weiber, erst werfen sie einem ihr Töchterchen an den Hals, dann spinnen sie Intrigen, tragen Briefchen hin und her. Ich kenne das. Wo ist der Brief?“
„Welcher Brief?“
„Den Dir deine Mutter brachte. Den Liebesbrief will ich haben! Her damit!“
„Ich glaube Du bist verrückt geworden.“
„Wo ist der Brief?“ rief Grünborn immer erbitterter.
„Höre“, rief Thekla, indem sie hochaufgerichtet dem Wütenden gegenüber trat, „wenn auch Du niedrig genug bist, solch schändliches Zeug von mir und meiner Mutter zu denken, ich würde mich selbst verachten müssen, wenn ich Dir darauf Antwort geben sollte.“
Grünborn wurde fast blau im Gesicht vor Wut. Seine Hand erhob sich zum Schlag, doch sich besinnend, stürzte er auf das Nähtischchen Theklas zu, riß die Lade heraus, warf alles darin Befindliche Stück für Stück zu Boden, indem er fortwährend rief: „O, ich werde ihn schon finden!“
Sein Suchen war umsonst. Als er auch in den anderen Schränken und Laden, die die Garderobe seiner Frau enthielten, alles vergeblich durchwühlt hatte, trat er wieder auf sie zu, die seinem wüsten Treiben mit bangem Staunen zugesehen hatte. Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück.
Grünborn faßte sie bei der Hand und sprach in befehlendem Ton: „Kehre Deine Taschen um!“
Thekla gehorchte ohne Säumen. Sie waren leer.
Die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen schienen den Eifersüchtigen endlich etwas besänftigt zu haben. Brütend ging er in dem Zimmer auf und ab, rüttelte an allen Türen, die zu den nach der Gassenseite liegenden Zimmern führten, ob sie wohl verschlossen seien und untersuchte, ob auch kein Versuch gemacht worden war, sie zu öffnen, denn der Unmensch hatte seine Frau auf das einzige Schlafzimmer beschränkt, welches die Aussicht zum Garten hatte, und selbst da wollte er in seiner eifersüchtigen Verblendung nicht dulden, daß seine Frau am Fenster sitze.
Das Mittagessen, welches er aus dem Gasthaus bezog, da er in Dienstboten nur Unterhändler in Liebesaffären erblickte, und es immer selbst dem Jungen, der es brachte, an der Haustür abnahm, ging begreiflicher Weise höchst traurig vorüber.
Kurze Zeit nach Tisch verließ er plötzlich das Zimmer, es sorgfältig hinter sich abschließend und kehrte erst nach ungefähr einer Stunde zu der, in banger Erwartung dessen, was noch kommen sollte, harrenden Gattin zurück.
Er war beladen mit mehreren starken Holzleisten, Hammer und Nägeln. Nach dem Eintritt verschloß er abermals die Tür, steckte den Schlüssel zu sich, und zündete ein Licht an. Dann schloß er an dem einen der Fenster den hölzernen Spalettladen, legte oben und unten eine der mitgebrachten Holzleisten quer darüber und befestigte sie mit einer hinreichenden Anzahl von Nägeln, so daß schon ein bedeutender Kraftaufwand erforderlich wäre, diese Verschalung nur mittelst Werkzeugen wieder zu eröffnen. Dieselbe Prozedur wiederholte er auch bei dem anderen Fenster, so daß das Tageslicht völlig ausgeschlossen und das Zimmer nur durch die angezündete Kerze notdürftig erleuchtet war.
Nach dem letzten Hammerschlag stieg er mit wahrhaft teuflischem Lächeln von dem, zum Festmachen der oberen Leisten benutzten Stuhl, legte Hammer und die übrigen Nägel bei Seite und trat mit einem satanischen Ausdruck in seinem Antlitz, sich boshaft die Hände reibend, vor seine erschrockene Frau, die seinem fast wahnsinnigen Treiben mit stummem Schrecken zugesehen hatte.
„Euer Gnaden“, sprach er kichernd, „jetzt ist es vorbei mit dem Kokettieren und Herumgucken. So strahlend ihre und seine Augen auch immerhin sein mögen, diese Läden werden sie nicht durchdringen!“
„Anton!“ rief Thekla erschrocken aus, „was soll das bedeuten, wozu dieses Vernageln der Fenster?“
„Das heißt, daß ich nicht will, das Du hinaussiehst und jemand anderer herein.“
„So soll ich in dem einzigen Zimmer, welches Du mir ohnedies läßt, das Tageslicht nicht sehen?“
„Nein, ich finde dies auch gar nicht nötig. Das Licht der Kerzen ersetzt die Sonne ganz gut und Du hast noch den Vorzug, daß für Dich immer schönes Wetter sein wird.“
„Du kannst mich noch verspotten, Grausamer, und ich bin doch schon so elend, so elend!“ rief die arme Frau, in Tränen ausbrechend.
„Das ist nicht meine Schuld! Aber ich, ich lasse mich nicht betrügen von meinem Weib.“
„Anton, höre! Ich beschwöre Dich! Gib diese unglückliche Idee auf, die Dich beherrscht, für welche Du keinen, nicht den geringsten Grund anzugeben hast. Daß ich Dich nicht liebte, habe ich Dir nie verborgen, aber die Zeit, die Gewohnheit, die alles versöhnt, hätte auch hier ihren freundlichen Einfluß nicht verfehlt. Von dem Moment an, wo ich Dir am Altar die Hand reichte, war ich fest entschlossen, den Pflichten, die meine Ehe mir auferlegt, in jeder Hinsicht nachzukommen, Dir ein gehorsames, ergebenes Weib zu sein und den Schwur der Treue, den ich vor Gott geleistet, unverbrüchlich zu halten! Aber quäle mich nicht mit dieser furchtbaren Eifersucht! Fasse Vertrauen zu mir, Anton, ich bitte, ich beschwöre Dich!“
„Haha“, lachte Grünborn roh, „daß ich ein Narr wäre. Solch schöne Worte fördern mich nicht. Mein Sprichwort ist: Besser bewahrt, als beklagt. Was ich getan, ist gut und dabei bleibts. Die Besuche der Frau Mutter werden von nun auch eingestellt.“
Thekla wandte sich nach diesen Worten unwillig von dem Hartherzigen ab, setzte sich in eine Ecke und hielt ihr Taschentuch vors Gesicht.
Ihr Gatte nahm Hut und Stock, und verließ das Zimmer, es sorgfältig hinter sich abschließend. So machte er es mit allen Türen, die er passierte, da das Schlafzimmer, das entlegendste des ganzen Hauses, noch mehrere andere vor sich hatte. Dann begab er sich in das Kaffeehaus, wo er den Nachmittag ruhig und gleichmütig verbrachte, indes sein armes, unglückliches, verlassenes Weib daheim abwechselnd weinte, betete und das Ende ihres Daseins herbeiwünschte.
Den Eltern Theklas gegenüber hatte Grünborn sein Wort eingelöst. Er hatte ihre Verhältnisse geordnet und gab ihnen noch überdies Geld, wofür sie das Versprechen leisten mußten, ihre Tochter nicht mehr zu besuchen, indem, wie er mit heuchlerischer Miene versicherte, es die Bestimmung des Weibes sei, alles zu verlassen, um dem Mann zu folgen, da besonders im vorliegenden Fall, wo er sich die Liebe Theklas erst zu erwerben suchen müßte, jeder Einfluß von Außen Schaden bringen könnte.
Die gefühllosen, schändlichen, geldgierigen Eltern der armen Frau stimmten vollkommen mit den Ansichten ihres freigiebigen Schwiegersohnes überein, versprachen ihm, sich nicht mehr um Thekla kümmern zu wollen, da sie ohnedies wüßten, wie gut sie bei ihm aufgehoben sei. Die arme Frau war also ganz und gar verlassen und der Gnade und Ungnade ihres Peinigers ausgeliefert.
Obwohl abgeschlossen von aller Welt, ja sogar von dem freundlichen Licht der lieben Sonne, quälte sie Grünborn doch noch immer mit seiner Eifersucht. Eines Tages kam er besonders aufgeregt nach Hause.
„Nun weiß ich“, rief er gleich beim Eintreten, „warum Du mich nicht leiden magst, immer weinst und Dich unglücklich nennst.“
„Das weißt Du erst jetzt?“ erwiderte Thekla vorwurfsvoll.
„Ist es anders möglich bei der schändlichen Behandlung, die Du mir zu Teil werden läßt. Vertrauen mag Liebe erwecken, aber Tyrannei nur Haß und Verachtung.“
„Holla, wie sich das aufs hohe Roß setzt! Ich tue Dir ja nichts. Ich liebe Dich so sehr, daß ich Dich nicht verlieren will und darum bewache ich Dich. Aber Du haßt, Du verabscheust mich, weil Du bereits vor mir einen Geliebten gehabt hast. Gestehe es augenblicklich!“
Thekla wandte sich mit einem Ausdruck von Ekel von ihrem Quäler und antwortete nur durch ein Zucken der Achseln.
„Aha“, brüllte Gründborn, „Du antwortest nicht, Du fühlst Dich also schuldig. Auf der Stelle bekenne, wer der Mensch ist. Woher kennst Du ihn? Wo, wie oft hast Du ihn gesehen? Alles, alles, will ich wissen.“
Auch diesmal blieb Thekla stumm.
„Rede! Aha, Du liebst ihn noch immer, er erfüllt noch immer dein ganzes Herz, so daß für mich kein Platz mehr darin ist! Ich rate Dir, Weib, bekenne und bring mich nicht zum Äußersten. Aber die Wahrheit will ich wissen, die reinste, vollkommenste Wahrheit! Ich weiß ohnedies bereits alles. Du kannst mich also nicht belügen. Aber ich will ein Geständnis, ein volles aufrichtiges Geständnis aus Deinem Mund und ehe Du mir dies nicht ablegst, ehe will ich nicht aufhören, Dich zu peinigen. Du schweigst? Thekla, Thekla, was ich bis jetzt getan, war ein Kinderspiel gegen das, was noch kommen wird, wenn Du so verstockt bleibst. Ich sage es Dir ganz offen. Reize mich nicht länger. Ich will Dir Speise und Trank entziehen, wie ich Dir bereits das Licht entzog, um Deinen starren Sinn zu beugen. Und gestehst Du auch dann noch nicht, dann, höre wohl, dann will ich Dich martern, fürchterlich, gräßlich martern, ich habe die Mittel dazu!“
Er war bei den letzten Worten mit drohender Miene auf seine Frau zugetreten, die vor ihm, wie vor einem giftigen Insekt zurückwich. „Elender“, rief sie aus, „nichtswürdiges Ungeheuer! Hast Du mich geheiratet, um mir das Leben zur Last und Qual zu machen?“
„Flausen, nichts als Flausen, bekenne!“
„Ich habe nichts zu bekennen, ich weiß von nichts“, erwiderte Thekla, und auf die Knie sinkend, mit gerungenen Händen und tränenüberströmtem Angesicht rief sie aus:
„Oh, warum habe ich den Bitten meiner Eltern, dem Andringen dieses Mannes nachgegeben! Mein guter Engel hat mich doch so oft gewarnt: Hüte Dich vor diesem Mann, mit dem falschen, lauernden Blick, mit dem boshaften höhnischen Zug im Gesicht und dem heuchlerischen Lächeln auf den Lippen. Ach warum habe ich dieser Stimme nicht gehorcht und bin dem Schändlichen gefolgt, der mich Zoll um Zoll zu Tode quält!“
„Jetzt bist Du schon auf dem rechten Weg. Das sind die wahren Besinnungen, die Dich gegen mich beseelen! Oh, ich weiß das nur zu gut. Du hast es oft genug zu Deinen Eltern, Freunden und Freundinnen gesagt, wie jämmerlich zuwider Dir meine Visage ist, und daß sie Dir immer vorkommt wie das Gesicht des schlechten Kerls im Kreuzertheater. Nicht wahr, liebes Weibchen, ich bin recht gut unterrichtet. Habe ich aber so vielen anderen gefallen, haben so viele andere Leute, Männer und Frauen, mein Gesicht gar nicht so übel gefunden, so hättest Du auch dasselbe getan, wenn Dein Herz noch Dein Eigen gewesen wäre. Aber Du hattest es verschenkt, gewiß an einen blondgelockten Hungerleider, der nichts hat und nichts ist, aber seufzen und schmachten und schöne, süße Worte zu drechseln verstand. So einen unreifen, bartlosen Buben, den ich aber, hol mich der Teufel, noch finden muß und finden werde, und sollt ich ihn bis ans Ende der Welt suchen. Du wirst mir sagen, wie er heißt. Du, Elende, Treulose, oder ich, ich morde Dich!“ Thekla stieß einen Schrei des Schreckens aus.
„Mein Gott“, rief sie, „ der Mensch ist wahnsinnig!“
„Noch nicht, Du wirst mich aber dazu machen!“
„Du hättest ins Irrenhaus gehört und nicht vor den Traualtar!“
„Es kommt ja immer besser. Genug der Sottisen, ich will handeln. Das Frühstück, was Du heute Früh genossen, möge Dir wohl bekommen. Es war Dein letztes, auf wie lange, das hängt von Deiner Gefügigkeit ab. Du bekommst auch nicht einen Bissen mehr zu essen noch zu trinken. Ich will sehen, was der Hunger ausrichten kann.“
„Tu, was Du willst. Ich will nur sterben, ich werde dann am Glücklichsten sein, denn der Tod befreit mich von einem Scheusal, von …„
„Dafür kann Rat werden, holde Gattin“, unterbrach sie kalt der Elende, Hut und Stock ergreifend.
Er verließ das Zimmer, verriegelte und verschloß sorgfältig alle Türen der ohnehin abgelegten Wohnung und ging, dem Äußeren nach kühl und gleichgültig, im Inneren aber über wahrhaft teuflischen Plänen brütend, in seine Kanzlei.
Thekla befand sich allein. Sie horchte aufmerksam dem Geräusch der nach und nach abgeschlossenen Türen. Als alles still und ruhig war, und nur das schwere keuchende Atmen aus der Brust des armen Weibes mehr im Zimmer zu hören war, stürzte sie auf eines der verschalten Fenster zu, und versuchte mit ihren zarten, kraftlosen Händen diese Verschalung aufzureißen. Sie rüttelte und zerrte an dem Laden, und es gelang ihr, nach fast übermenschlicher Kraftanstrengung, den einen so weit aufzubringen, daß ein schmaler Streif des goldenen Sonnenlichtes ins Zimmer drang.
„Dem Himmel sei Dank“, rief sie aus, „es wird mir gelingen, das Fenster aufzubringen, ich werde dann in den Garten springen, und von da aus wird es mir leicht sein, zu entfliehen.“
Mit neuem Eifer machte sie sich an die Arbeit, aber, ach, all ihr Mühen, alle ihre Anstrengungen waren umsonst, der Laden wich auch nicht um eine Linie mehr. Da verließen sie ihre Kräfte, erschöpft, halb ohnmächtig, mit blutenden, zerrissenen Händen sank sie neben einem Stuhl zu Boden, ihr Gesicht in den gefalteten Händen verbergend und weinte bitterlich. Nach einer Weile richtete sie sich etwas auf, die verworrenen Haare mit ihren Handflächen aus dem trotz der erlittenen Qualen noch immer lieblichen Antlitz streichend, und sprach zu sich selbst: „Es ist umsonst. Ich bin gefangen, so muß es bleiben. Die Kräfte von zehn Männern reichten nicht aus, diese Laden zu öffnen, was soll ich, schwaches Weib, mit meinen zerfetzten, blutenden Händen. Ich sehe nirgends Hilfe, nirgends. Meine Eltern haben mich nur des elenden Geldes willen verlassen und verkauft. Gott verzeihe es ihnen! Was soll ich beginnen? Ist es denkbar, daß ich hier in Wien, mitten unter so vielen Menschen, so elend zu Grunde gehen soll, ohne Aussicht auf Hilfe, Rettung? Was mag der Elende nur mit mir vorhaben? Er sagte, er wolle mich martern, furchtbar martern!? Das werden wohl nur Drohungen sein. Und doch, wenn ich die bodenlose Schlechtigkeit seines Gemütes bedenke, die sich nur zu gut in seinem scheußlichen Antlitz ausprägt, wenn ich an seine schurkischen, blutgierigen Augen denke, oh da fühle ich mich durchdrungen von der Überzeugung, daß dieses Ungeheuer zu allem fähig ist, daß ich das Entsetzlichste von ihm zu fürchten habe. Gottes Willen geschehe! Ich will aber die Geschichte meines Lebens aufschreiben, und der Allmächtige wird zulassen, daß man sie finde.“
Eine Weile blieb das arme, bedauerungswürdige Weib in stillem Gebet auf den Knien, dann erhob sie sich rasch und schrieb emsig auf ein Blatt Papier, was wir dem Leser bereits erzählten.
Es mochte sieben Uhr Abends sein, als ein lebhaftes Geräusch Thekla belehrte, daß ihr Peiniger nach Hause gekommen war. Schnell faltete sie das Blatt Papier, auf welches sie geschrieben hatte, zusammen und verbarg es unter einem Kasten.
Ängstlich lauschte sie und das dumpfe Gepolter, welches ein im Nebenzimmer zu Boden geworfener Gegenstand verursachte, machte sie unwillkürlich erbeben. Die Schritte ihres Gatten entfernten sich wieder. Ein neues Geräusch, als ob jemand mit einer schweren Last beladen ins Zimmer träte, ließ sich nun vernehmen, und die zitternd Lauschende hörte abermals das Auffallen eines schweren Gegenstandes. Sie versuchte durch das Schlüsselloch zu sehen, aber der von außen steckende Schlüssel verhinderte jede Durchsicht.
Von einem furchtbaren Bangen ergriffen, was das alles zu bedeuten haben möge, zog sie sich in eine Ecke des Zimmers zurück, sank dort in einen Stuhl und sandte heiße Gebete zum Himmel, sie aus den ihr drohenden Gefahren zu retten.
Plötzlich öffnete sich die Tür, heller Lichtschein strahlte ins Zimmer, auf der Schwelle erschien Grünborn und rief mit gebieterischer Stimme seiner Frau zu: „Komm, folge mir ins Nebenzimmer!“
Ruhig stand Thekla auf und gehorchte dem Befehl. Als sie die Schwelle überschritten hatte, schloß Grünborn die Tür hinter ihr wieder ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. Das Zimmer, welches die beiden nun betreten hatten, war viel kleiner als das Schlafzimmer und hatte nur ein Fenster, welches mit einer Matratze verschalt war. Ein am Plafond hängender kleiner Luster war mit fünf Kerzen besteckt, die, angezündet, einen hellen Schein in dem kleinen Gemach verbreiteten. In der Mitte desselben, einem großen Spiegel gegenüber, stand ein altertümlicher, sonderbar aussehender Holzstuhl, dem eine Menge von eisernen Klammern und Ringen ein unheimliches Aussehen verliehen. An der Seite desselben lag am Boden ein, dem Anschein nach mit Werkzeugen gefüllter, grober Sack, der stellenweise zerrissen und über und über mit eklichem Schmutz bedeckt war.
Mit bangem Staunen betrachtete Thekla diese beiden Gegenstände, sowie den in hellem Kerzenlicht strahlenden Luster. Eine unnennbare Angst bemächtigte sich ihrer. Wankend stützte sie sich an einen Türpfosten, und blieb, in starres Anschauen versunken, eine kleine Weile daran lehnen. Die raue, widrige Stimme ihres Gatten weckte sie aus ihrer Erstarrung.
„Thekla“, redete er sie an, „meine Geduld ist am Ende. Ehe ich zu dem furchtbaren Werk, das ich vorhabe, schreiten will, fordere ich Dich nochmals auf, mir ein offenes Bekenntnis abzulegen. Nichts sonst kann Dich retten.“
Wie im Traume blickte die arme Frau ihren Mann an.
„Was soll ich bekennen“ fragte sie flüsternd und beklommen.
„Du fragst noch?! Ich will wissen, und das aus Deinem Mund, daß Du vor mir einen Geliebten gehabt hast, daß Du ihn noch liebst, ihn allein in Deinem Herzen trägst und immer und ewig nur an ihn denkst. Ich will wissen, wie er heißt, wo er ist, wo ich den Elenden finden kann. Also nenne ihn mir Thekla, zum letzten Mal, nenne ihn mir!“
Thekla raffte sich auf: „Ich habe keinen Geliebten“, erwiderte sie, ihn mit bittenden Blicken ansehend, „und ich habe nie, nie einen gehabt. Ich hatte niemals Umgang mit Männern und lernte, außer meinem Vater, nur einen Einzigen näher kennen und der bist Du, der Du mich zu Tode quälst und marterst ohne einen anderen Grund, als Deine unberechtigte blinde Eifersucht! Du solltest doch dies alles ebenso gut wissen, wie ich. Du hast Dich doch hinreichend nach mir erkundigt, hast doch seit meiner frühesten Jugend an bis zu dem Tag, wo Du mich am Altar zu Deinem Weib machtest, jeden meiner Schritte bewacht oder bewachen lassen. Hast Dich doch bei allen möglichen Leuten, Freundinnen und Bekannten von mir und meinen Eltern, ja selbst beim Hausmeister, bei allen Nachbarn, bei allen Höckerinnen in unserer Nähe nach mir erkundigt, und was man Dir dort sagte, sprach nur für mich, bewies meine Unbescholtenheit aufs Vollkommenste. Man nannte mich die Männerfeindin, und ich verdiente diesen Beinamen eher als nicht. Ich hatte eine instinktartige Scheu vor den Männern, als ob ich geahnt hätte, welches Elend, welchen Jammer Einer aus diesem Geschlecht über mich bringen würde!“
„Immer dieselben schönen Redensarten“, höhnte Grünborn, „damit fördert man mich nicht. Ich habe zu viel Erfahrung in den Kniffen und Ränken der Weiber. Zum letzten Mal sage ich Dir jetzt: Bekenne!“
„Und zum letzten Mal sage ich Dir, ich habe nichts zu bekennen!“, sprach Thekla, diesmal mit fester Stimme.
„Nichts?“ brüllte der Verruchte, „nichts? Dann werde ich Dich dazu zwingen!“
Rasch faßte er das schwache Weib an den Schultern und stieß sie in den bereits beschriebenen Lehnstuhl, der mittelst seiner eisernen Spangen und Klammern sein Opfer von allen Seiten umschlang und festhielt, so daß sie jeder Fähigkeit, sich zu bewegen, beraubt war.
Thekla stieß ein entsetzliches Geschrei aus.
„Schrei wie Du willst, bis daß deine Lunge berstet“, brüllte Grünborn, „ich habe wohl gesorgt, daß Dich Niemand hören kann.“ Er warf Rock und Weste ab, öffnete, unbeirrt durch das Jammern und Wehklagen der Gefesselten, den alten schmutzigen Sack und leerte dann, ihn an beiden unteren Enden ergreifend, eine Menge sonderbar geformter, alter, rostbefleckter Instrumente mit einem Mal zu Boden.
„Nun, höre noch einmal“, sprach er dann zu ihr, „stelle Dein unnützes Geschrei einen Augenblick ein. Als Assessor des Kriminalgerichts habe ich mir aus den Kellern des peinlichen Gerichtshauses diesen Stuhl, der Dich so hübsch festhält und diese verschiedenen Universal-Remedia, verstockte Sünder zum Bekenntnis zu bringen, verschafft. Sieh nur her“, fuhr er fort, ihr ein Instrument nach dem anderen vorzeigend, „das hier sind die Daumenschrauben. Da hinein steckt man den Daumen des Delinquenten, dann dreht man mittelst dieser Schraube hier zu, und setzt das nach Umständen so lange fort, bis das Blut beim Nagel herausspritzt und der Knochen zu Brei zerquetscht ist. Das tut eben nicht wohl. Das hier sind die sogenannten spanischen Stiefel. Diese zwei Brettchen kommen an die innere Seite der Schienbeine, die beiden an die äußere, dann umwickelt man das Ganze mit einem guten, haltbaren Strick und treibt zwischen die inneren Brettchen, je nach Bedarf, einen, zwei, drei, auch vier dieser hölzernen, eisenbeschlagenen Keile. Beim ersten werden die Füße rot wie Zinnober, beim zweiten springen die Adern und das Fleisch, um dem gepreßten Blut Ausgang zu verschaffen und Du glaubst, daß die Knochen zerquetscht werden. Beim dritten Keil aber geschieht dies wirklich, der vierte tötet unfehlbar! Ich glaube, du hast genug gehört, obwohl ich noch andere Mittelchen hier habe, wenn diese nicht genügen sollten. Zwinge mich nicht dazu. Ich habe Dich vorsätzlich diesem Spiegel gegenübergestellt, damit Du sehen sollst, welch furchtbare Verwüstungen die Martern, die Du erdulden sollst, diesem Gesicht einprägen werden. Also, rede! Gestehe! Bekenne!“
„Ich habe nichts zu bekennen!“ erwiderte das halbohnmächtige, vor Schreck erstarrte Wesen mit tonloser Stimme.
Da schien sich eine furchtbare Wut Grünborns zu bemeistern. Mit einem Fluch warf er seine dunklen Augengläser in eine Ecke, wo sie klirrend zerbrachen. Unter fortwährenden wüsten Verwünschungen und Schimpfreden riß er der armen Thekla die Kleider stückweise vom Leib. Seine Augen, blutunterlaufen, leuchtend vor Grausamkeit und Wut, traten aus ihren Höhlen, mit offenem Mund und gefletschten Zähnen, gleich einem nach Blut lüsternen Raubtier, begann er sein entsetzliches Verbrechen und ließ, vom Jammer und Wehgeschrei der armen Gemarterten gänzlich ungerührt, sie alle Grade jener entsetzlichen Erfindungen des Mittelalters fühlen, durch die man in der vormaligen geistesfinsteren Zeit armen Unglücklichen oft Geständnisse von Schandtaten und Verbrechen entlockte, die sie nie begannen hatten.
In seinem Eifer, in seiner Raserei bemerkte er gar nicht, daß das Geschrei seines Opfers immer schwächer und schwächer wurde, und endlich ganz verstummte. Wütend trieb er den vierten Keil zwischen die blutüberströmten, zerquetschten Füße. Da schien ihm erst das Stillschweigen Theklas aufzufallen. Der Hammer, mit dem er soeben zum Schlag ausholte, entfiel seiner Hand. Er erhob den Kopf und sah, wie der seiner Frau auf die Brust herabgesunken war. Wie von einer Feder geschnellt, sprang er auf, richtete ihn empor, und blickte in das fast bleifarbene, vom Scherz bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Antlitz Theklas, deren erloschene, glanzlose Augen den Fluch des Himmels auf ihren schändlichen Mörder herabzurufen schienen. Da gingen ihm die Augen auf über das unerhörte, entsetzliche Verbrechen, welches er soeben begangen hatte. Er rief, schrie, rüttelte, doch umsonst, kein Hauch kam von den blauen, geöffneten Lippen, das Leben war erloschen. Thekla war tot!
Eine wahnsinnige Angst ergriff ihn nun. Eilig nahm er ihr die Daumenschrauben von den Händen, die spanischen Stiefel von den Füßen, öffnete die Klammer des sie umschlingenden Folterstuhles und trug den Leichnam der Unglücklichen in das Schlafzimmer, wo er ein Bett abräumte und sie hineinlegte. Dann räumte er die Marterwerkzeuge samt dem Stuhl in eine Ecke des Kabinetts, deckte einen Teppich über die am Boden befindliche Blutlache, verlöschte die Kerzen am Luster und stürzte fort in eine nahe gelegene Offizin, um einen Chirurgen zu holen, der seiner Frau noch Hilfe bringen sollte.
Es schlug zehn Uhr. Als der Chirurg in die Wohnung kam, führte er ihn an das Bett, in welchem Theklas Leichnam lag.
Der Chirurg erblaßte, als er das entstellte Antlitz der toten jungen Frau erblickte, und als er um den Puls zu fühlen, ihre Hand ergreifen wollte und daran den blutigen, bis zur Formlosigkeit zerquetschten Daumen sah, blickte er schreckensvoll zu dem Mann, der, in einen Stuhl gesunken, das Gesicht mit den Händen bedeckend, regungslos dort verharrte.
Leise schob er die Hand wieder unter die Decke, und sprach zu Grünborn:
„Es ist umsonst, hier ist nichts mehr zu helfen, die Frau ist tot.“
Grünborn antwortete nicht. Der Chirurg ging leise fort. Kaum am Gang angekommen, stürzte er jedoch mehr als er ging die Treppe hinunter, in das Zimmer des Hausmeisters und rief ihm zu: „Eilen Sie, laufen Sie fort! Holen sie eine Polizeipatrouille! Hier im Haus ist ein Mord geschehen!“
Der erschrockene Hausmeister öffnete den Mund zu einer Frage, doch der Chirurg drängte ihn zur Tür hinaus.
„Gehen Sie, auf ihre Verantwortung, fragen Sie jetzt nichts.“
Der Hausmeister eilte fort, während der Chirurg im Vorhaus auf und ab ging, um einen etwaigen Fluchtversuch des Mörders zu verhindern und die Patrouille zu erwarten.
Nach ungefähr zehn Minuten kam der Hausmeister wieder, in Begleitung eines Polizeikommissars und vier Mann Polizeisoldaten. Der Chirurg, vor Aufregung keines Wortes mächtig, führte sie in die Wohnung Grünborns, den er in derselben regungslosen Stellung antraf, wie er ihn verlassen hatte. Auch der Eintritt der Patrouille erregte ihn nicht. Der Tatbestand wurde rasch aufgenommen und die Verstümmelung der Gliedmaßen, sowie die aufgefundenen Folterwerkzeuge gaben hinreichenden Aufschluß. Die Entdeckung der, von Thekla niedergeschriebenen Geschichte ihres Leidens, die ein Soldat von der Tür aus liegen sah und dem Kommissar aushändigte, vervollständigte das Ganze.
Als der Kommissar Grünborn aufforderte, ihm zu folgen, erhob dieser den Kopf und blickte ihn mit stieren, fast blödsinnigen Augen an, ohne sich vom Stuhl zu erheben. „Sie müssen mir folgen“, wiederholte der Kommissar, „ich verhafte Sie hiermit wegen Mordes!“
Auf diese Worte erhob er sich und bot seine Hände willig den Fesseln dar, die ihm einer der Polizeisoldaten anlegte.
Die Wohnung wurde verschlossen und versiegelt und der Mörder in einem herbeigeholten Fiaker ins Gefängnis abgeführt.
Die Untersuchung begann, und die Details derselben erfüllten Richter und Beisitzer mit Schauder und Abscheu vor dem gefühllosen, entmenschten Bösewicht.
Da die Todesstrafe zu jener Zeit für Zivilpersonen abgeschafft war, wurde Grünborn zu lebenslänglichem schweren Kerker verurteilt. Die nie ruhende göttliche Gerechtigkeit aber schlug ihn mit unheilbarem Wahnsinn; nicht mit jener Art, die die davon Befallenen ein stilles, traumhaftes Blumenleben, welches sie unmerklich, Schritt für Schritt, dem Grabe näher bringt, führen läßt, sondern mit jenem grauenhaften Wahnsinn, der seine Opfer ewig mit Gespenstern des Schreckens und Grauens umgibt, deren sie sich in Anfällen der furchtbaren Tobsucht und Raserei zu erwehren suchen.
Theklas Eltern, deren Gefühllosigkeit und schändliches Benehmen in die Öffentlichkeit drang, und die deshalb von allen besser Denkenden gemieden wurden, hatten mit dem Blutgeld, für das sie ihre Tochter verkauften, wenig Glück. Der Vater ergab sich schlechter Gesellschaft und dem Trunke, die Mutter dem Lotteriespiel und in Folge dessen wurden ihre Verhältnisse bald zerrütteter denn je.
Beide starben im Elend.