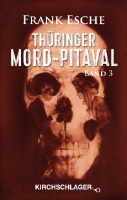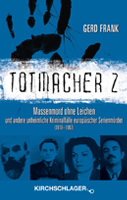In dem ärmlichen Harzdorf Allrode, an der anhaltschen und preußischen Hoheitsgrenze im Herzoglich Braunschweigischen Kreisamt Hasselfelde gelegen wohnt schon seit langer Zeit der jetzt ganz arme Tagelöhner Christoph Glahn. Er war dreimal verheiratet. Zwei seiner Frauen liegen still und christlich beerdigt auf dem kleinen Kirchhof zu Allrode. Die dritte liegt im Kerker zu Blankenburg und erwartet ihr Lebensende auf dem Rabenstein.
Die erste Frau war eine geborene Brehme, und hinterließ ihm das Unglückskind, welches am 15. Juni 1806 geboren wurde, und in der heiligen Taufe die Namen Johanne, Dorothee, Christine, Henriette empfing. Die zweite Frau war in Kindsnöten gestorben. Das kaum geborene Kind war ihr ins Grab gefolgt.
Jetzt war Glahn also wieder Witwer, ein Mann in seinen besten Jahren, tüchtig und rüstig verdiente er bei der Waldarbeit sein reichliches Auskommen. Er besaß zudem ein Häuschen und zwei Stückchen Gartenland. So war er ein gemachter Mann, der, wie man im gemeinen Leben sagt, überall anklopfen konnte. Sein Hauswesen bedurfte einer Stütze und sein schwächliches Kind einer Pflegemutter. Deshalb ging er denn mit einem echt christlichen Gemüte 1808 zum dritten Mal auf die Freite.
Auf dem Vorwerk Grünthal hatte er während der Heuernte ein Mädchen kennen gelernt, welches dort diente. Sie hieß Christiane Herfurth und war die Tochter armer Landleute zu Trautenstein. Früh hatte sie ihre Eltern verloren, war dann von einer Tante erzogen worden, gehörig zu Kirchen und Schulen gehalten und in der lutherischen Konfession konfirmiert. Bis dahin hatte sie durch redlichen Fleiß ihren Unterhalt erworben. Im Jahre 1786 geboren, war sie damals 22 Jahre alt, und besaß ein kleines Ersparnis, alles Eigenschaften, die ihm das Mädchen zur Hausfrau empfohlen. Voll Hoffnung auf ein glückliches Leben führte er sie heim und glaubte damit eine redliche Mutter seinem schwächlichen, halbverwaisten Kind zugeführt zu haben. Aber wenn der Mensch sich auch seine Zukunft selbst bereitet, so bleibt sie ihm doch immer dunkel und geheimnisvoll verborgen. So hatte der arme Mann, ohne es zu ahnen in der lauten Freude seines Herzens, seines Lebens Unglück und seines Kindes Mörderin in sein Haus geführt.
Das erste Jahr verging und er segnete seine Wahl. Die Frau sorgte tätig für sein Hauswesen und nahm sich des kleinen Stiefkindes mit Freundschaft an. Gern ertrug deshalb der gar geduldige Mann die oft üblen Launen, der mitunter zanksüchtigen Frau als kleine Dornen, die auf dem blühenden Rosenstrauch der glücklichsten Ehe selten zu mangeln pflegen.
Das erste Kind aus dieser Ehe starb gleich nach der Geburt. Das trübte schon einigermaßen das Verhältnis der Mutter zu dem Stiefkind. „Warum du, mein armer kleiner Liebling?“ seufzte sie weinend, über den kleinen Sarg hinübergebeugt, „und nicht das fremde Kind?“
In den folgenden Jahren gebar sie noch drei Kinder. Damit aber trat die Bösartigkeit ihres Gemüts immer feindlicher dem ihr anvertrauten Pflegling entgegen. Die reine mütterliche Liebe ist ein sehr erhebendes, rein menschliches Gefühl, welches die Vorsehung in die Natur des Weibes legte, um das Menschengeschlecht im Gedeihen seiner zartesten Keime zu erhalten. Wenn aber dieses Gefühl, ohne jegliche Erhebung den Gemüts, in rohen Naturen als ein heftiger tierischer Trieb erscheint, so ist es nicht selten mit einer Selbstsucht gepaart, die die Rückwirkung desselben auf fremde Kinder, die einer solchen Mutter anvertraut sind, höchst gefahrvoll macht.
Ein solcher selbstsüchtiger Trieb einer heftigen Mutterliebe war aber dieser dritten Frau des Handarbeiters Glahn in einem hohen Grade eigen. Sie legte dies durch viele kleine Züge an den Tag. Namentlich war während ihrer Haft die Sorge für ihre Kinder, ihr steter Gedanke. Sie hungerte, um von ihrer Beköstigung eine Unterstützung für ihre Kinder zu ersparen. Dieser Trieb war aber auch das einzige Zeichen von Gefühl n ihrer Seele. Im Übrigen sprach Neid, Haß, Mißgunst und ein beständiges inneres Grollen aus den scheuen, menschenfeindlichen Blicken ihrer grauen, tiefliegenden Augen. Ihre vergilbten Gesichtszüge waren tief gefurcht durch die Gewalt heftiger Leidenschaften und einer selten ruhenden Zanksucht.
So waren schon die scharf hervortretenden Grundzüge ihres Charakters Unheil bringend für das hilflose Stiefkind, welches Tage- und Wochenlang, während der Vater sich weit entfernt bei der Waldarbeit befand, einer solchen Stiefmutter Preis gegeben war. Tagelang mußte das schwächliche kleine Dortchen die wohlgenährten Kinder ihrer Stiefmutter tragen. Wenn diese aus Eigensinn weinten, so bekam das Stiefkind dafür die Schläge.
Kam spät Abends der Vater von der Arbeit in die Hütte zurück, und schmeichelnd nahte sich das mißhandelte kleine Wesen, von einem dunklen Naturtrieb geleitet, dem finsteren, mißlaunigen Mann, und hoffte dort Schutz zu finden, so stand auch schon die Stiefmutter daneben, und wußte mit geläufiger Zunge und gleißenden Worten, dem gutmütigen aber nur zu leichtgläubigen Mann, ein solches Sündenregister von seines Kindes unverbesserlichen Untaten herzuzählen, daß dieser sein schon zitterndes Kind mit Unwillen zurückstieß oder gar mit Schlägen mißhandelte.
Aber es fügte sich auch, daß der Mann von Nachbarn und Gevattern auf das Betragen der Stiefmutter aufmerksam gemacht wurde. Mitleidige Menschen brachten ihm wohl die Kleine und zeigten ihm die blutigen Streifen auf dem weißen abgemagerten Rücken seines Kindes. Und die Natur regte sich in der Brust des rohen Vaters. Wild lief er nach Hause oder kehrte abends grollend, in stiller Wut zurück in seine von Rauch durchzogene Hütte. Alsdann entstanden Szenen unter den Eheleuten, von denen der gebildete Mensch keine Vorstellung besitzt. Nicht selten mußten Nachbarn oder Ortsobrigkeiten beide mit blutigen Köpfen auseinander bringen.
Daß am folgenden Tag das arme kleine Dortchen jeden Schlag, den die hartherzige Stiefmutter empfangen hatte, doppelt zurück erhielt, begreift wohl jeder, der einmal Gelegenheit hatte, tiefer in die Natur eines solchen unglücklichen Verhältnisses hineinzublicken. Aber das Maß der Leiden dieses unglücklichen Kindes sollte noch höher steigen. Der Vater hatte sich dem Trunk ergeben. Die Wirtschaft ging rückwärts. Er verkaufte ein Stückchen Garten nach dem andern. Die Arbeit ging nicht mehr von statten. Not und Hunger vermehrten den häuslichen Unmut, der Branntwein verstärkte die Ausbrüche der Rohheit.
Unter solchen drückenden Verhältnissen mußte aber notwendig die Gemütsart des Kindes eine störrische und stöckische Richtung annehmen. Dabei geschah es, daß die Mutter das Kind öfter betteln schickte. Kam es nach Hause und brachte nichts, so waren Schläge sein empfang. Kamen die kleinen Diebstähle aus, so wurden sie mit blutigen Schlägen von Seiten der Stiefmutter geahndet, kamen sie nicht aus, so war wohl der Lohn des Kindes, sich einmal einen Tag satt zu essen und keine Stöße und Schläge zu empfangen. So erreichte das Kind unter einer Last von menschlichem Elend das elfte Jahr seines Lebensalters. Da erst ereignete sich ein Vorfall, der das Gericht von den Mißhandlungen in Kenntnis setzte, die das verwahrloste Geschöpf zu erdulden hatte.
Die Rabenmutter hatte es bei den Haaren aus dem Haus gezogen, auf den Düngerhaufen niedergeworfen, mit Füßen getreten und mit der Mistgabel geschlagen und gestochen, so daß die blutigen Striemen und leichte Stichwunden am Körper des Kindes noch zu sehen waren. Das Weib, bei der es schon lange kein Ehrgefühl mehr zu schonen gab, sollte öffentlich ausgepeitscht werden. Nur ihre Schwangerschaft veranlaßte die Verwandlung der körperlichen Züchtigung in Gefängnisstrafe. Sodann wurde dem unglücklichen Kind von Gerichtswegen ein Vormund bestellt, und da unter den ausgemittelten Umständen keine Sicherheit mehr für dasselbe im väterlichen Haus zu erwarten war, so wurde es diesem Vormund zur Erziehung übergeben. Dem Vater wurde auferlegt, die kleine Beisteuer zur Erhaltung des Kindes von seinem Lohn abzureichen.
Dieser Vorfall führte zur Ermittlung der Vermögensverhältnisse der Familie Brehme, und es fand sich, daß das mütterliche Erbteil des verwahrlosten Kindes, teils veräußert, teils gefährdet war. Andere Gläubiger traten hinzu und der Konkurs brach über das geringe Glahnsche Vermögen aus. Das Haus wurde schließlich gerichtlich verkauft.
Man denke sich das Zusammentreffen von so vielen Umständen, die schnell hintereinander nicht nur den letzten Schimmer von Wohlstand in dieser Familie unterdrückte, und dieselbe aus der Klasse der Hausbesitzer in die Klasse der Mietlinge versetzte. Niemand wollte sie aufnehmen mit ihrem Häufchen Kinder, bei dem Vorwurf ihrer unfriedfertigen Lebensart. Die Sorge, alljährlich 8 bis 10 Taler für Hausmiete aufzubringen (ein hohes Kapital für solche Leute), kam dazu der Groll und Ärger über die gerichtliche Einmischung, über die erduldete Strafe, über die Entziehung des Gegenstandes ihrer Rache, alles das stürmte auf ein Weib von so beschränkten Begriffen und roher Gemütsart ein, so daß es wohl nicht anders sein konnte, als daß sie die ganze Schuld ihres Unglücks dem armen Kind beimaß, und der Haß, der früher wohl nur eine ewige Aufregung des Jähzorns gewesen sein mochte, mußte nach und nach zur giftigsten Feindschaft heranreifen.
Es kam dazu, was sich bei der völligen Unfähigkeit solcher Menschen, rechtliche Verhältnisse richtig aufzufassen, wohl erklären läßt, daß zugleich bei Beiden die Idee entstand, wenn das Kind verschwunden sei, so würde auch das Vermögen, ihnen, den Eltern, wieder zufallen. So erhob sich neben dem Haß, wenigstens auch bei der Stiefmutter der Wunsch, daß das Kind von der Welt verschwinden möge und sie rang der Hölle den Seufzer ab: „Ach wäre das Unglückskind nur erst tot!“
Verlassen wir auf einige Augenblicke dieses düstere Seelengemälde, und wenden uns zu dem Kinde, dessen Leibliches und Seelenheil in den Händen des redlichen Vormundes wir gerettet zu sehen hoffen. Aber dem war nicht so. Die böse Saat im jungen Herzen war auf diesem Weg nicht mehr auszurotten. Das Kind wurde mit Strenge zur Schule gehalten, sollte zu Reinlichkeit und Ordnung angehalten werden, aber das Stillsitzen und die regelmäßige Lebensart war dem verwilderten Kind eine noch größere Pein, als die Mißhandlungen, wobei es doch tagelang oft sich selbst überlassen war. Es lief fort und bettelte auf den Dörfern umher. Der redliche Vetter Rienäcker, so nannte sich der Vormund, schritt unverdrossen von Dorf zu Dorf, führte es wieder zurück und klagte dann mit bitterem Gram dem Gericht seine Not.
Dann geriet auch die Zahlung der Erziehungsgelder von Seiten Glahns ins Stocken, und der selbst von Nahrungssorgen gedrückte Vormund konnte die Erhaltung des Kindes nicht mehr ertragen. Nach dem Verkauf seines Hauses hatte Glahn die Waldarbeit fast gänzlich aufgegeben, und war in eins der Diensthäuser des Gutes gezogen. Dadurch war es ihm möglich geworden seinen geringen Verdienst gegen die Beschlagnahmung von Seiten des Gerichts zu sichern, und dem Vormund das Erziehungsgeld zu entziehen.
Plan war es offenbar von beiden Eltern, das Kind wieder in ihre Gewalt zu bekommen, besonders scheint er aber von der Stiefmutter ausgegangen zu sein. Sie selbst schmeichelte dem Kinde, wo sie dasselbe nur ansichtig werden konnte und gab ihm Naschwerk. Sie fragte es öfter, ob es denn auch dort satt zu essen bekomme? Und das kleine Mädchen war schlau genug, durch Klagen über den Vormund sich die Gunst und Gaben der Stiefmutter erwerben zu wollen. Dann wurden alle solche Beschwerden der kleinen Lügnerin ihrem Vater, weit übertrieben, hinterbracht. Das Mädchen, von der Stiefmutter abgerichtet, weinte über Hunger und Mißhandlungen, an denen kein wahres Wort war, und der aufs höchste gereizte rohe Mensch ging dem redlichen Vormund mit Vorwürfen und Drohungen zu Leibe. Das Kind entlief seinem Vormund, wenn es nur konnte. Hatte derselbe es dann tagelang gesucht, so erfuhr er nicht selten, daß es die Glahnschen Eheleute an sich gelockt und in ihrer Wohnung versteckt gehalten hatten. Unter solchen Prüfungen erliegt endlich auch die langmütigste Geduld. Es mußte ein anderer Vormund bestellt werden. Dieser hieß Brehme und war ein Bruder der Mutter des Kindes. Aber dieselben Vorfälle erneuerten sich wieder und das Kind mußte den Eltern zurückgegeben werden. Diese hatten Besserung gelobt, und dem Onkel als Vormund verblieb die Aufsicht.
Fröhlich und wohlgemut bezog das kleine Mädchen wieder das Haus seines Vaters. Aber der Mensch geht nur zu oft, ohne es zu ahnen, froh und heiter seinem dunklen Schicksal entgegen. Lachend betrat es – seine Mördergrube.
Es war kurz vor Weihnachten 1816, da meldete Vormund Brehme, das Glahnsche Kind sei verschwunden. Die nächsten Nachforschungen ergaben Folgendes: Im Backhaus zu Allrode war ein Brot entwendet worden und man hatte Verdacht auf das kleine Dortchen, weshalb man eine Hausvisitation in der Glahnschen Wohnung beschloß.
Es war am Abend, da kam die Glahnsche Ehefrau mit ihrem Stiefkind den Fußsteig vom Holze her gegangen. „Mutter“ rief plötzlich das Kind, „da kommt Vetter Christoffel und der lange Schmidt! Was mögen die wollen?“
Es war der Ortsvorsteher und der Geschworene, die langsam und gravitätisch auf das Glahnsche Haus zuschritten. Im Brotschrank lag halb verzehrt das entwendete Brot. „Mach das du fortkommst!“ entgegnete die Mutter, „Sie suchen das Brot. Hier sind vier Groschen, fort, fort!“
Ohne sich umzusehen lief das dünn und ärmlich gekleidete Kind in die heraufdämmernde Winternacht hinein, dem großen Walde zu. Nach menschlichen Berechnungen war das elfjährige Mädchen schon jetzt ohne Rettung verloren. Vergeblich suchte es der Vormund. Später erfuhr man, daß wenige Tage später, am heiligen Christabend, die kleine Glahn weinend und zitternd vor der Tür der Witwe Ehrig gestanden hatte, von dieser aufgetaut und mit Speise und Trank erquickt worden war. Am folgenden Morgen wanderte die kleine Vagabundin nach Breitenstein, um sich dort von dem Stiefbruder ihres Vaters eine kleine Weihnachtsgabe zu holen.
Nach einiger Zeit machte die Glahn dem Gericht die Anzeige, daß es ihr zwar gelungen sei, das ungeratene Kind in Breitenstein aufzufinden, jedoch sei es ihr wieder entlaufen, als sie auf dem Rückweg nach Allrode in Günthersberge in einen Bäckerladen gegangen sei, um dem halb verhungerten Kind eine Semmel zu kaufen, während dasselbe auf der Straße habe stehen bleiben sollen. Von hier an war jede Spur von dem Glahnschen Kinde wie abgerissen. Vergeblich wurden gerichtliche Bekanntmachungen erlassen. Ein unsicheres Gerücht lief um, daß das Kind in dem großen Teich hinter Günthersberge ertränkt worden sei. Die Eheleute Glahn wurden eingezogen, mußten aber nach einiger Zeit wieder entlassen werden, denn keiner der verschiedenen Verdachtsgründe, deren Spuren verfolgt wurden, führten zu der Entdeckung des Verbrechens.
Jahre vergingen. Man hörte nichts von dem verschwundenen Kind. Inzwischen wuchs der Verdacht gegen die Glahnsche Ehefrau im Publikum fast bis zur moralischen Überzeugung. Beide Eheleute lebten scheu und zurückgezogen von Menschen, und die Menschen wichen ihnen aus wie einem ansteckenden Fieber.
Seit dem Verschwinden des Kindes hatte weder Glahn noch seine Frau die Kirche besucht. Und das will viel sagen in einer kleinen Gemeinde, in der noch die gut alte Sitte herrscht, daß allsonntäglich jeder Hausvater gewissenhaft den vormittäglichen Gottesdienst wenigstens besucht, die Gesänge absingt und während der Predigt mitunter ein Morgenschläfchen nachholt.
Der Prediger hatte die Eheleute Glahn dringend aufgefordert, das heilige Abendmahl zu nehmen, aber erbleichend war der Mann zurückgeschaudert, da er wohl ahnen mochte, daß das Gewissen seines Weibes von der Blutschuld nicht rein ist, und auch diese hatte es nicht gewagt, so Schuldbeladen sich Gottes Tisch zu nahen.
Während nun die schuldige Glahnsche Ehefrau Jahrelang ihre Seelenangst mit sich durchs Leben schleppte, ereignete sich im Herzoglich Anhaltschen Amt Harzgerode ein Vorfall, der vielleicht früher zu der Entdeckung des Verbrechens geführt hätte, wenn er früher dem untersuchenden Gericht bekannt geworden wäre.
Wenn man von Alexisbad aus in dem romantisch schönen Selketal aufwärts wandelt, und die Silberhütte, auch über dieser noch eine Mühle zurückgelassen hat, so steigt links aus dem Talgrund ein tiefer Hohlweg die waldige Höhe hinauf. Ist man oben angelangt, wo der Hohlweg sich bis auf wenige Fuß Tiefe verflächt, und der Forstort Wolfsberg das Neuendorfer Feld berührt, so erblickt man etwa 10 Schritt links von diesem, nach Siptenfelde führenden Weg, ganz vorn im Wald einen offenen Schacht, mit einer von rohen Baumstämmen leicht gezimmerten Einfassung.
Nicht ohne geheimen Schauer sieht man hinunter in die dunkle Tiefe. Der obere Rand derselben ist durch das hineingeschossene, lockere Erdreich, welches die Felsen des Gebirges bedeckt, zu einem regellosen Schlunde erweitert worden. Wilde Schlingpflanzen, Wurzeln und zerrissene Moosdecken hängen, als Fortsetzungen des bewachsenen Waldbodens, über dem schweigenden Abgrund. So weit man hinunter sehen kann, ragen die grotesken Gestalten von zackigen Felsen in das Dunkel hinein, dann sperren sich einige morsche Balken von der zerfallenen Verzimmerung mitten über den Schlund, von einer Wand zur andern, und unter denselben beginnt ein so dunkles, tief verborgenes Chaos, daß es unmöglich ist bis auf den Grund des Schachtes hinunter zu blicken. Wirft man Steine hinein, so fallen sie springend von Felsen zu Felsen und dann dumpf tönend zwischen die losen Balken in der Tiefe, und es schallt herauf wie die erste Schaufel voll Erde, welche in ein tiefes Grab auf einen frisch versenkten Sarg geworfen wird.
Es war am 2. November 1820, als die Bergleute Martin Gille der Jüngere und Caspar Engelhard, beide aus Neuendorf, zum Wegfüllen der sogenannten Berge den 100 Fuß tiefen Schacht befuhren. Sie gelangten mit ihrer Arbeit bis an die Stelle, wo ein Stollen den Schacht durchschneidet.
Plötzlich rief der Eine: „Da liegen Knochen. Muß etwa ein Stück Wildpret von oben hereingestürzt sein?“ Ohne die Knochen näher zu untersuchen, wurden sie mit dem Abraum von Erde und Schutt hinunter in die Teufe gestürzt. „Ein Kopf – ein Menschenkopf!“ schrie auf einmal der Andere entsetzt, und kollerte zwischen dem Gestein mit der Spitzhaue den braunen, vermoderten Schädel hervor. Man wurde aufmerksam, und fand noch einen Knochen. Weiter war keine Spur mehr von den Gebeinen zu finden. Beide Gegenstände wurden zur näheren Untersuchung an das amt Harzgerode abgeliefert.
Es war ein kleiner Kopf, ohne gewaltsame Knochenverletzung. Der Unterkiefer fehlte. Die Zähne waren ausgefallen, mit Ausnahme von zwei Backenzähnen. Der Knochen war der obere linke Schenkelknochen eines Menschen. Der Herzogliche Anhaltsche Physikus, Doktor Kurze, vermutete aus der Richtung des oberen Knochenfortsatzes am Beinknochen, daß der Knochen einem Menschen weiblichen Geschlechts angehört habe. Die Backenzähne waren als sogenannte Weisheitszähne erkannt. Dieser Umstand führte ihn zu der Vermutung, daß die Person, von der der Schädel stammte, 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein müsse.
Eine Bekanntmachung des Vorfalls wurde vom Herzoglich Anhaltschen Gericht nicht erlassen, weshalb auch das untersuchende Kreisgericht Hasselfelde denselben nicht erfuhr. Soviel war wenigstens nicht zu bezweifeln, daß hier die Spuren eines großen Verbrechens zu Tage gefördert waren. Mord oder Selbstentleibung konnten höchst wahrscheinlich nur den Menschen, dessen Gebeine gefunden waren, in diesen dunklen Schacht hinabgestürzt haben.
Die Untersuchung wider die verehelichte Glahn wurde 1823 wieder aufgenommen. Im Zuge der Vernehmungen zerbrach nach und nach ihr Lügengespinst. Dabei beging sie eine erste Unvorsichtigkeit und erzählte von einer Vagabundin, die sie als Begleiterin gehabt haben soll und die sie bereits von früher kannte. Um sich mit ihr abzusprechen und um keine widersprüchlichen Aussagen vor Gericht zu machen, beschloß die Glahn die Vagabundin aufzusuchen. Schließlich sollte ihre Angst vor der Entdeckung die Entdeckung des Verbrechens herbeiführen.
Es war 14 Tage vor Pfingsten 1823, da ging die Glahn den schweren Gang, der sie retten sollte aus dem dunklen Gewinde ihres verlorenen Lebens, der aber, denn der Mensch denkt es und Gott lenkt es, sie auf den Rabenstein führte. Wo sie die Unger, so hieß die Vagabundin, die Weihnachten 1816 mit ihr gegangen war, um ihr Stiefkind zu suchen, finden sollte, das wußte sie nicht. Aber sie setzte voraus, daß eine gewisse Christiane Klapproth ihr beim Aufsuchen behilflich sein könne.
Beide Weiber gingen nach Rottleberode, wo die Schwester der Unger auf der Pfarre diente. Hier erfuhren sie, daß die Unger sich in Heringen bei Nordhausen aufhalten müsse. Nun wanderten beide dorthin, erfuhren aber nur, daß die Unger fortgewandert war, wohin, wußte niemand zu sagen. Die innere Angst der Glahnschen Ehefrau wurde immer reger. Schließlich vertraute sie sich der Klapproth an und erzählte ihr, daß sie ein Kind gemordet hatten.
Doch wir wollen der Erzählung des ausgemittelten Verbrechens nicht vorgreifen. Die schwarze Giftfrucht ihres Lebens war gereift durch die Zeit zum Abfallen. Die Klapproth hatte, jedoch erst am 22. Juni 1823 dem Pastor von Peinen zu Allrode, Anzeige vom Geständnis der Glahn gemacht. Vor diesem und dem Ortsvorsteher hatte die Verbrecherin in ihrer Hoffnungslosigkeit das Bekenntnis der Tat erneuert, und am folgenden Tag lag sie in Ketten, im Kerker zu Hasselfelde.
Auch die Unger wurde auf Requisition eingezogen. Die Untersuchung wider dieselbe wurde vor dem Gerichtsstand ihres Domizils, dem Gräflich Stollbergschen Amt Rottleberode, unter fortgesetzter Kommunikation mit dem Kreisgericht Hasselfelde geführt. Im Sommer 1824 war die Untersuchung wider die Glahn geschlossen. Am Anfang Oktober 1825 wurde dieselbe nach Blankenburg an das Distriktsgefängnis abgeliefert, weil nach der veränderten Gerichtsverfassung, diese Sache zur Kompetenz des Herzoglich Braunschweigischen Distriksgerichts Blankenburg gehörte. Das Resultat der Untersuchung erzählen uns die folgenden Abschnitte.
Es war der heilige Christabend 1816, da stellte sich das düstere Bild des auf immer untergegangenen häuslichen Glücks in der Glahnschen Hütte um so schneidender dar, je mehr man gewohnt ist, an diesem Abend sich nur fröhliche, jubelnde Kinder, bei hundert Lichtern zu denken, und glückliche Eltern, denen in der Freude ihrer Kinder, die herzen für Liebe und Heiterkeit und Dankgefühl gegen Gott aufgehen. Dort aber, im Haus des Elends glomm düster ein spärlich genährtes Lämpchen in der kleinen, überheizten Stube.
Auf der Ofenbank lag in sinnloser Trunkenheit der Vater der vier Kinder, die halb nackt am feuchten Erdboden umherkrochen und wimmerten. Grollend mit sich selbst und der Welt, saß deren Mutter am halbzerfallenen Tisch, und hatte den Kopf in beide Hände gestützt, nichts um sich her beachtend. Draußen heulte der Brockenwind und jagte Schneewolken über den entlaubten Forst herbei. Schrillend fuhr der Zugwind durch die mit Lumpen schlecht verwahrten, zerbrochenen Fenster. Das Wehen und Flackern der Lichtflamme warf schaurige Streiflichter auf das Helldunkel des betrübenden Bildes. Da klopfte es draußen. Das Weib schrak zusammen und hauchte auf. Es klopfte wieder. Zu träge, um in ihrer unfreundlichen Stimmung aufzustehen, dachte sie, laß klopfen wer da will, wird wohl eine Nachbarin sein, und legte grollend den Kopf auf den Tisch.
Plötzlich pochte es stärker, ganz nahe am Fenster. „Nun denn, in Teufelsnamen herein!“ rief die Glahnsche Ehefrau aufspringend, und schob den Riegel von der Doppeltür des Hauses auf. Hustend und pustend, grollend und schmollend schritt ein Weibsbild über die Schwelle, klein, breit und untersetzt von Statur, mit tückischen, fast zugeschwollenen Augen. Einer kleinen roten Nase, die wie eine Warze in der Mitte des breiten Gesichts kaum sichtbar war, ein beständig geifender Mund und rotgelbe, in dünnen Striemen über das scheußliche Antlitz herüberhängende Haare, vollendeten das Bild des menschlichen Ungeheuers, welches, aus reiner Mordlust später die Mordgehilfin der Glahnschen Ehefrau wurde.
An dem Abend, der der Christenheit heilig ist, weil an demselben das Jesuskindlein geboren wurde, hatten sich diese beiden Mörderinnen eines hilflosen Kindes zusammengefunden.
Christine Unger, so hieß die Eintretende, war in der Grafschaft Stollberg, in Rottleberode geboren, damals etwa 30 Jahre alt, hatte sie von Kindesbeinen an ein Landstreicherleben geführt. Zu Kirchen und Schulen war sie nicht gehalten, das siebente Gebot (???) schien sie nur mechanisch zu kennen. Alles an ihr verriet rohe, tierische Gefühllosigkeit, womit jedoch jene verderbliche Schlauheit verbunden war, die sich solche Menschen bei ihrem Herumstreichen oft unter dem Auswurf der Menschheit zu erwerben wissen.
Diese Person war jetzt zufällig auf einer ihrer Streifereien nach Allrode gekommen. In der Glahnschen Hütte erbat sie sich ein Nachtlager, was der Glahnschen Ehefrau gelegen kam. Sie konnte nun der früheren Bekannten einmal so recht ihr Herz ausschütten, über das ungeratene Stiefkind, welches sie vor wenigen Tagen erst fortgejagt hatte. Und erzählte, wie dasselbe ein Brot gestohlen hatte, landflüchtig geworden war und wie man nun von ihr verlangte, das Satanskind herbeizuschaffen, und sie nichts als Gram und Sorgen mit ihm hatte.
„Glahnsche!“ sagte die Versucherin leise, „wenn es nur von der Welt wäre, das wäre besser für es selbst und für euch.“ „Ach, wenn es doch der liebe Gott nur einmal erst hingenommen hätte!“ seufzte die Glahn. „Ich will euch schon führen!“ flüsterte die Unger, „Ich gehe mit euch, Glahnsche.“
Jetzt erwachte der Mann derselben. Auch kam ein alter, vom Betteln und Besenbinden lebender Hausgenosse herein, und nun trat an die Stelle des menschenfeindlichen Schweigens eine so wahrhaft höllische Lustigkeit, als hätten damit die letzten Regungen der Menschlichkeit gegen den schon mehr als halb gefaßten Vorsatz zum Mord, betäubt werden sollen.
Am folgenden Morgen regte sich noch einmal das bessere Gefühl in der Brust des Weibes. Noch war es zwischen ihr und ihrer Genossin nicht ausgesprochen, das schauderhafte Wort, vor welchem selbst der Mörder zurückbebt, aber beide wußten ohne Zweifel, was beide voneinander zu erwarten hatten.
„Glahn,“ rief dessen Ehefrau, „geh selbst, such das Mädchen! Du bist Vater! Ich habe ein saugendes Kind, bin schwach.“ „Ich auch, ich bin krank.“ Gab er finster zurück. „Mann, Mann, laß mich nicht mit dem erschrecklichen alten Tiere gehen!“ rief sie in steigender Angst. „Es geht mit dir. Es weiß auf allen Dörfern bescheid!“ entgegnete er in einem gebietenden, unfreundlichen Ton, der keinen Widerspruch zuließ und fuhr fort: „Hast du mein Kind zur Landläuferin erzogen, so magst du ihm nachlaufen. Weib! Du bist Rabenmutter gewesen. Ich sage mich los von dem Kinde, aber du hast es auf dem gewissen. Nun sieh zu, wie du damit fertig wirst.“
Der Vater hatte sein Kind aufgegeben. Der Weihnachtsmorgen war still und hell. Im Dorf wurde zur Kirche geläutet, aus allen Türen traten andächtige Männer und Frauen hervor und schritten langsam in Feierkleidern der kleinen hölzernen Dorfkirche zu. Von Haus zu Haus liefen geputzte Kinder mit fröhlichen Festgesichtern und zeigten ihre empfangenen Weihnachtsgaben oder holten neue Geschenke von ihren Taufpaten zusammen. Draußen aber, dem Walde zu, schritten die Mörderinnen, eine hinter der anderen hergehend im schmalen Schneesteig, ihrem Höllenwerk entgegen.
Beide schwiegen, jede mit ihren eigenen schwarzen Gedanken beschäftigt. Von Zeit zu Zeit unterbrach die Glahn das tiefe Schweigen durch Klagen über das ungeratene Kind. „Ja, ich sage es immer. Ihr habt doch nur Schimpf und Schande von dem Kinde. Wenn ich an eurer Stelle wär, Glahnsche, ich wüßte wohl, was ich täte.“ Die Glahn horchte auf, indem sie erwartete, daß jene sich näher aussprechen werde. Allein die Unger schwieg.
So kamen beide Weiber auf die mit niedrigem Unterholz bestandene Höhe, von welcher herab man tief im Bergkessel das ärmliche Dorf Trautenstein, mit seinen vereinzelt liegenden Schindeldächern sehen kann. „Mir ist nicht zu helfen. Bringe ich es wieder zurück, so geht die Not von neuem los.“ Seufzte die Glahn. Jetzt wendete die Unger, die vorausging, sich halb um und blieb stehen, und sprach mit der ihr eigenen widerlich krächzenden Stimme: „Glahnsche, ich weiß ein Schachtloch, da führe ich euch hin.“
„Der Schacht ist doch nicht mehr gangbar?“ fragte die Glahn nach einer langen Pause.
Die Unger verzog ihr scheußliches Gesicht zu einem teuflischen Lachen und versicherte: „Was da wieder einfährt an Menschengebeinen, das hört keinen Kuckuck mehr rufen.“ Bei dem Bruder der Glahn in Trautenstein übernachteten beide Weiber. Die ganze Nacht hindurch flüsterten beide miteinander, und der Gegenstand ihrer leisen Gespräche war das Kind und der Schacht. Am folgenden Tag wanderten sie über Benneckenstein und Sophienhof, und wandten sich dann wieder rückwärts nach Stiege zu.
„Wo liegt der Schacht?“ fragte die Glahn.
„Im Anhaltschen, ganz im Walde.“ War die Antwort.
„Er ist doch tief? Man könnte sonst nicht wissen…“ hob jene an und brach wieder ab. Es war an einer recht heimlichen Stelle des hochstämmigen Waldes. Die Unger blickte scheu umher. Dann sagte sie mit geheimnisvoll gedämpfter Stimme: „Ich will Euch mal einen Spaß erzählen, Glahnsche! Ich hatte einen Liebsten, einen Schneidergesellen, einen Nordhäuser. Seht! Der hielt sich zu einer andern! Wart`, denk ich, das soll dir eingetränkt werden. Wir waren beide auf der Wanderschaft und kamen an den Schacht, den ich meine. Ich sage, wir wollen ausruhen. Und wir setzen uns dicht an den Rand. Ob er wohl tief ist? Frage ich. Mein lieber Schneider legt sich mit der Nase über den Rand und sagt: Ich sehe keinen Grund. Dann such ihn! Spreche ich und gebe ihm den Gnadenstoß ins Genick. Der sucht heute noch den Grund und Boden, Glahnsche, wenn er`s nicht vergessen hat. Aber weder Hund noch Hahn hat danach gekräht.“
„Ihm ist wohl dran!“ seufzte die Glahn.
In Stiege erfuhren beide, von einem kleinen Diebstahl des Kindes, und daß es nach Breitenstein habe gehen wollen. Als die beiden Weiber die waldige Höhe herabstiegen, von wo aus jenseits des Tals auf der Höhe das herrschaftliche Jagdhaus von Breitenstein mit seinen Hirschgeweihen auf dem Giebel gesehen werden kann, sprach die Glahn vor sich hin, wie sich selbst beruhigend über das bereits heimlich beschlossene Verbrechen: „Nun ja, das muß wahr sein, es ist auch kein gutes Haar mehr an dem Satanskinde. Bringe ich es zurück, es kommt noch an Galgen und Rad.“
„Glahnsche!“ rief die Unger mit ihrer heischern Stimme, „helft ihm von der Welt. Ihr verdient ein Gotteslohn!“
Das Unerhörte war ausgesprochen. Vor dem Namen seines Verbrechens schaudert der Mörder oft mehr zusammen, als vor der Tat. Die Glahn schwieg. Nach einer langen Pause aber, hob sie an: „Freilich, wenn ich es recht bedenke, gar viel Leben ist so nicht mehr in dem Kinde. Es ist ja nur noch so ein Dingelchen, ein Häufchen Elend. Aber, ja, wenn man nur wüßte…“ Sie stockte.
„Tut es, Glahnsche, tut es! Ich helfe mit! Dann seid ihr auf einmal alle Sorgen los und ledig.“ Krächzte das andere Weibsbild hinter ihr herschreitend.
Die Glahn aber erklärte sich nicht näher über ihre Absicht, und rastlos wanderten sie weiter, dem Dorfe zu, wie vom bösen Feind getrieben. Gegen die Abenddämmerung traten sie in die Hütte des Tagelöhners Sander, eines Halbbruders von Glahn. Im dunkeln Hintergrund des kleinen Gemachs wimmelte es von halbnackten Kindern. Eins von ihnen, blaß und hohläugig, schob sich an der Wand fort, der Tür zu, als es beide Weiber eintreten sah. Aber die Unger packte es, bückte sich und stierte mit ihren kleinen grünlichen Augen das zitternde Kind so mordsüchtig an und rief ihm höhnend zu: „Sieh Kröte! So haben wir dich ja.“
Es war das Glahnsche Kind, das Dortchen, welches da, von furchtbarem Entsetzen ergriffen, wie leblos zu Boden sank. Die Natur übte noch einmal ihr Recht. Beim Anblick des Opfers schauderte die Mutter innerlich zusammen. Aber die letzte Regung der Menschlichkeit war zu schwach, in ihrer, schon dem Bösen verfallenen Seele, um mehr als ein Schwanken ihres Willens erwecken zu können. Und dazu hatte die Versucherin auf dem nächtlichen Strohlager ihren geifernden Mund dicht an das Ohr des Weibes gelegt, und flüsterte die ganze Nacht hindurch ihr scheußliches: „Tut es, Glahnsche, tut es!“
Es dämmerte der Tag. Die Weiber rüsteten sich, um mit dem Kind die letzte Reise anzutreten. Der Tagelöhner, bei dem das Kind Schutz gefunden hatte, ermahnte die Glahnsche Ehefrau auf seine Weise recht dringend ihr Stiefkind gut zu behandeln, es zu Kirchen und Schulen anzuhalten und auf keine Weise sich an demselben zu versündigen.
„Base“ sagte er, ihre Hand ergreifend, „gelobt das mir, es würde noch dermaleinst Eure Sterbestunde drücken, wenn ihr nicht so tätet an dem Kinde, wie es einer redlichen Mutter ansteht.“
„Ach!“ sagte sie, „an dem Lork (???) ist einmal Hopfen und Malz verloren.“
„Base, ich sehe wohl, Ihr habt ein Herz von Stein und Eisen“ sprach der Mann bewegt, „mög`s Euch Gott nicht vergelten, wenn es zu spät wird, zu bereuen. Ich aber will mit Euch gehen, und mein Wort dem rechten Vater ans Herz legen. Denn hier bei Euch stehe ich doch nur wie ein Prediger in der Wüste.“ Damit langte er nach dem Kittel, der am Nagel hing. Aber die Glahn, um ihn vom Mitgehen abzuhalten, gelobte, was er verlangte und beruhigt entließ der brave Mann die beiden Weiber mit dem Kind.
Jetzt aber, teilnehmender Leser, waffne Dein Gemüt mit Standhaftigkeit! Du siehst das unglückliche Kind, welches sein Schicksal bereits ahnt, zwischen den beiden Weibern dem Walde zugehen. Du weißt, was sie vorhaben. Du siehst, wie jedes dieser Weiber eine Hand des zitternden Kindes ergreift, und erbarmungslos damit fortschreitet auf den einsamsten Waldwegen, welche selten eines Menschen Fuß betreten hat. In Deiner Brust wohnt ein fühlendes Herz. Eine innere Stimme wird es Dir klagen, was das kleine schwächliche, aber schon elfjährige Kind empfinden mußte, da es von Minute zu Minute die Gefahr deutlicher erkannte, und, eingeschüchtert wie es war, nirgends einen Schimmer von Hoffnung erblickte, keine Bitte wagte, keine Klage laut werden ließ.
Doch wir müssen noch einen Umstand erwähnen. Wenn ein Mensch im Strome untersinkt, so greift er nach dem letzten dürren Reis, welches neben ihm schwimmt, obwohl es ihn nicht retten kann. So auch der Mensch, dessen Seele im Strudel eines großen Verbrechens untergehen will. Er greift wenigstens nach dem Schein der Selbsttäuschung, als habe er die Tat nicht gewollt, sei aber dazu durch ein höheres Verhängnis fortgerissen. Schon dieses rettungssuchende Umsichgreifen der menschlichen Natur im Menschen, ist ein mildernder Zug im Auge des Weltenrichters, und auch unserem Gemüt ist es wohltuend, wenn wir nicht ganz ohne Kampf den letzten Funken der Gottheit im Menschen erlöschen sehen müssen.
Vor dem Dorf scheiden sich zwei Wege. Der Eine führte zur Rettung, der Andere zum Tode. Jener zur Reue, dieser zum Verbrechen. Der Erste nach Allrode, der Zweite zum Mörderschacht. Wie oft steht der Mensch, fast ohne es zu wissen, auf einem ähnlichen Scheideweg? Tugend und Laster, sie liegen wohl weit voneinander entfernt im Leben, aber ihre Bahnen laufen auf einem Steige fort, bis die Versuchung naht. Dann steht Ihr am Scheideweg. Wohl euch, wenn Ihr mit euch selbst im Klaren seid, und die Festigkeit habt, den rechten Weg zu beschreiten.
Auch die Glahn stand und zweifelte. Aber sie erkannte nicht klar, was sie sollte, und hatte nicht die Kraft der leisen und letzten Mahnung ihres Gewissens zu folgen. Sie stellte die Entscheidung auf die Spitze einer zweideutigen Frage. Sie fragte: „Wohin geht der Weg?“ und täuschte sich selbst damit, daß sie bei dieser Frage Allrode im Sinne gehabt habe.
„Dort hinauf! Dort hinauf!“ rief die Unger, in die Richtung nach Harzgerode deutend. Noch einige schritte ging die Glahn auf dem andern Weg fort. Aber die Unger zog sie am Rock und krächzte mit ihrer heischern Stimme: „Dort hin! Dort hin liegt der Schacht!“
Die Glahn stand noch einen Augenblick und schwankte, dann folgte sie der Versucherin. Der Mord war unwiderruflich beschlossen. So schritten denn beide Weiber auf den einsamen Waldsteigen, ihrem dunklen Ziele immer näher. Zwischen sich führten sie das unglückliche Kind, oder, wo es der Raum im dürren Gesträuch von Unterholz nicht gestattete, nahm eine um die andere das Opfer ihrer Unmenschlichkeit bei der Hand. Dabei sprachen sie in halbleisen Andeutungen mit abgerissenen Worten über die Art der Ausführung ihres Vorhabens. Doch ist es leider nur zu gewiß, daß das zehneinhalb Jahre alte Kind, welchem durch seine vereinzelte Stellung auf der Welt ein ungewöhnlicher Grad von Scharfsinn und Beobachtungsgabe zu eigen geworden war, alle diese nicht eben vorsichtig gemachten Reden wohl verstanden habe.
Zwischen Breitenstein und Schwenda öffnet sich hart am Weg ein verfallener Schacht. Die Glahn blieb stehen, hielt das Kind fest und fragte ihre Genossin: „Ist das der Schacht?“
„Noch nicht!“ sagte diese, und beide wanderten weiter mit dem Kind.
„Aber wenn es gröhlt (laut schreit)?“, fragte die Glahn, nach einiger Zeit.
„Das gibt sich, nur die Kehle zugeschnürt.“ war die Antwort.
„Aber einen Strick…?“ warf die Glahn ein.
„Eine Wehde tut`s auch!“ versetzte die Unger und riß von einem Weidenbaum einen schlanken Zweig ab und drehte im Weitergehen eine Schlinge an das dünne Ende desselben.
„Mutter, sind wir nicht bald in Allrode?“ fragte das Kind in Todesangst, mit leiser, zitternder Stimme. Weiter wagte es nichts zu sagen. Es wurde ihm keine Antwort gegeben. Die Weiber zogen es fort, und die Unger drehte noch immer an der Schlinge.
„Glahnsche!“ rief die Unger plötzlich, „Aber das sage ich zum voraus, um den Hals lege ich ihm die Wehde nicht. Das müßt ihr selbst tun.“
Schon drei Stunden waren sie gewandert, und Allrode liegt ungefähr nur drei Viertelstunden von Breitenstein. Das wußte die unglückliche Kleine recht gut, und darum stieg auch ihre Angst mit jeder Minute. Bei dieser letzten Bemerkung aber fuhr das Kind vor innerem Entsetzen zusammen, und fragte noch einmal: „Kommen wir denn noch immer nicht hin?“
„Bald, bald!“ entgegnete die Unger mit einem grinsenden Lachen, und warf dabei einen bedeutsamen Wink auf ihre Gefährtin.
Nicht lange nachher stand sie still und horchte, ging dann suchend rechts und links in die Büsche, kam gleich darauf zurück, faßte heftig das Kind beim Arm und führte es wenige Schritt vor.
„Da“ sagte sie, und deutete in die Tiefe einer Grube, die sich dicht vor ihren Füßen in der weißen Schneedecke des Waldbodens öffnete, „wir sind zur Stelle, Glahnsche, nun macht`s kurz und gut!“
Die Glahn war hinter das Kind getreten und hatte es an einem Arm fest gefaßt. Ihr schauderte vor dem Beginnen der Tat, und sie seufzte: „Ich kann nicht!“
„Hier habt ihr die Wehde.“ sprach die Unger und überreichte ihr den zur Schlinge gedrehten Weidenzweig. „Seht, so müßt ihr ihn umlegen um den Hals und dann fest anziehen, bis es erdrosselt sein wird.“
„Tut ihr es!“ bat die Glahn.
„Ei, das ist ja Eure Sache, nicht meine.“ Entgegnete die Unger. „Ich will indes seitab ein Vaterunser beten, damit uns der liebe Gott die Sünde vergibt.“
Damit entfernte sich dieses schaudervolle Geschöpf in einer kaum menschlichen Gestalt einige Schritte, kniete nieder und erhob die gefalteten Hände, und während es zu dem allwissenden, ewigen und allmächtigen Richter der Welten betete, v e r g i b u n s u n s e r e S c h u l d, v o l l e n d e t e d i e v o n i h r v e r f ü h r t e V e r b r e c h e r i n d e n a l l e s m e n s c h l i c h e G e f ü h l s o t i e f e m p ö r e n d e n M o r d a n d e m h i l f l o s e n, i h r e r P f l e g e a n v e r t r a u t e n K i n d e.
Halb tot schon vor Schreck und Entsetzen war dieses vor den Füßen seiner erbarmungslosen Stiefmutter niedergesunken. Zwischen ihre Knie hatte die Letztere den Kopf des Kindes festgehalten, mit der Linken den Körper desselben gegen den Boden gedrückt und dann mit der Rechten den Weidenstrang so fest angezogen, bis kein Zucken mehr in den Gliedern des Kindes ein Lebenszeichen verriet.
Da lag die Kinderleiche zu den Füßen der Mörderin.
„Gott hat es zu sich genommen!“ sagte diese mit einem Anflug menschlicher Rührung, das tote Kind betrachtend.
Auch die Unger trat herbei, aber mehr mit einer rohen tierischen Regung von Neugier. „Nun frisch, werft es hinunter, Glahnsche!“ sagte sie.
„So faßt doch mit an“, forderte die Glahn, „damit ich es doch nicht allein getan habe.“
„Das werde ich wohl bleiben lassen.“ entgegnete die Unger. „Ich habe schon ein Vaterunser gebetet. Mein Gewissen ist wieder frei.“
Eben wollte die Glahn Anstalt machen, das tote Kind in den Schacht zu werfen, da dachte sie an ihre Kinder zu Hause und sagte: „Das bißchen Lumpen können meine armen Kinderchen noch gebrauchen!“
Die kleine Regung eines menschlichen Gefühls war diesem Gedanken gewichen. Sie entkleidete mit kaltem Blut die Kinderleiche bis auf das Hemd, und stürzte nun dasselbe hinunter in den verfallenen Schacht.
Von Felsen zu Felsen, von Balken zu Balken wurde der Körper hinab in die Tiefe geschleudert. Dumpf und immer dumpfer hallte es herauf von dem mehr und mehr beschleunigten Fall. Jetzt war der letzte hohle Klang verschollen und still war es in dem über hundert Fuß tiefen Grab.
Die beiden Weiber legten sich auf den Rand des Schachtes nieder und horchten hinab. Nach einer langen Pause stand die Glahn auf und sagte: „Nun Gott sei Dank! Dem Kind ist wohl dran. Es war doch nichts mehr nütze auf der Erde.“
Dann kniete auch sie auf den Rat der Unger nieder und erhob die Mörderhände zum Allmächtigen und betete das Gebet des Erlösers, wähnend, damit ihre Seele von aller Blutschuld gereinigt zu haben.
In Hinsicht der Teilnahme der Unger an der Vollziehung des Mordes gab es zwischen den Aussagen der beiden Verbrecherinnen eine Differenz. Die Glahn behauptete, daß die Unger dem Kind die Wehde um den Hals gelegt, auch mit angefaßt habe, um den Körper in den Schacht zu werfen. Die Unger indes leugnete, unmittelbar bei dem Mord mit Hand angelegt zu haben. Für die Strafbarkeit der Glahn machte diese Differenz keinen Unterschied, da soviel keinen Zweifel unterlag, daß ihre freiwillige und unerlaubte Handlung die Ursache des von ihr beabsichtigten Todes des Kindes gewesen war. In psychologischer Hinsicht aber stimmt es durchaus mit dem Charakter beider Teilnehmerinnen mehr überein, wenn wir annehmen, daß sich die Sache so begeben habe, wie wir sie, hinsichtlich der Differenz, nach der Aussage der Unger erzählt haben. (C. Ludwig)
Durch ein Erkenntnis des Fürstlichen Landgerichts zu Wolfenbüttel vom 13. August 1824 ist die Inquisitin verurteilt worden: Daß sie mit dem Rade vom Leben zum Tode gebracht werden solle, und dass der Körper derselben alsdann auf das Rad zu flechten sei. Allerdings milderte der Durchlauchtigste Herzog das Urteil in die Gnade des Schwertes um. Die Mordgehilfin Dorothea Unger wurde von den betreffenden preußischen Gerichten zur Strafe des Schwertes (Enthauptung) verurteilt.
Wir können des Schlusses dieser Erzählung wegen nicht umhin, hier noch eine kleine Mordgeschichte einzuschalten.
Im Osten graute der Morgen. Der Köhlerbube weckte die Jäger, und diese erhoben sich und traten aus der schwarzen kegelförmigen Köthe hinaus in die feuchte Morgenluft des Hochwaldes. Es war ein Berufsweg, auf dem sie das Leben einsetzen mußten, ohne zu wissen, ob sie das Leben zurück empfangen würden. Sie waren am vergangenen Abend von Allrode ausgegangen, um auf Wildschützen zu achten, welche den herrlichen Wildbestand des Allroder Reviers schon häufig zum Gegenstand ihrer verwegenen Raubzüge gemacht hatten.
Der reitende Förster Küchler aus Allrode teilte seine Begleitung in zwei Partien. Während er selbst mit dem Fußjäger Krebs sich in den Forstort Bosleich begab, beauftragte er seinen Revierjäger Stöcker, den herrschaftlichen Jäger Bodenstein und den Fußjäger Hennings den Forstort Wildstein, oberhalb des in den Klippen des Budetals (Bodetals?) versteckten, fast verfallenen Grubenorts Treseburg zu durchsuchen.
Der Jäger Stöcker war ein großer, schlanker junger Mensch von 25 Jahren, Sohn eines würdigen Hüttenmannes zur Oker, geliebt und geachtet wegen seiner Treue im Dienst, Entschlossenheit und Rechtschaffenheit. Mit einem gewissen schweren Vorgefühl, welches sich durch manche hingeworfene Äußerungen verriet, ging er voraus, am dichtbewachsenen Berghang hin. Es war der 8. Juni 1823, der ihm zum verhängnisvollen Tag werden sollte.
Schon am Abend vorher waren von dem preußischen Harzstädtchen Beneckenstein aus zwei Männer fortgegangen über Hasselfelde hinaus, den Allroder Forsten zu. Der Eine hieß Löhning und war ein rascher, kräftiger junger Mann, der im Äußeren weder etwas abschreckendes, noch etwas auffallendes hatte.
Der Andere hingegen, ein kleiner, sehr gewandter Kerl, namens Christoph Ziegler, aus Treseburg gebürtig, hatte das Äußere eines wilden Gesellen. Seine Züge und besonders ein ihm ganz eigener Blick verrieten ebenso viel Schlauheit wie Tücke. Das dünne, schon grau werdende Haar hing in langen Striemen über die hohe, weit entblößte Stirn. Sein Profil war, genau betrachtet, schön und regelmäßig zu nennen, aber so sehr entstellt von einer wüsten, ungeregelten Lebensweise, daß schon sein Anblick ein gewisses heimliches Grauen erregte.
Dazu trug er einen langen, schadhaften Oberrock und eine Tuchmütze. Er war Striegelschmied seines Zeugnisses nach. Durch einen Ehescheidungsprozeß mit einer wohlhabenden Frau war er um Haus und Hof gekommen, und lebte jetzt in einer wilden Ehe mit einer Person, namens Müller, mit der er schon vier Kinder gezeugt hatte. Sein Gewerbe, in einer gemieteten Schmiede, ohne Vorlag, ernährte ihn nur kümmerlich. Deshalb hatte er den Vorsatz gefaßt, gleich manchem anderen Einwohner von Beneckenstein auf Wilddieberei auszugehen, um dadurch seine Lage zu verbessern.
Kaum hatten diese beiden Menschen das Allröder Forstrevier betreten, so schlich sich Ziegler seitwärts ab, und langte unter den wurzeln eines hohlen Baumes eine sorgfältig versteckte kleine Büches hervor. Es war eine sogenannte Wilddiebsflinte, ein ganz kurzer Lauf mit einer Kolbe, die durch eine einzige schnelle Bewegung abgenommen werden konnte.
Das Gewehr war geladen. Ziegler untersuchte die Pfanne, und schüttete Pulver darauf. Schweigend wanderten nun beide Wildschützen weiter. Indes war es Nacht geworden. Sie erwarteten, unter einem Baum hingestreckt, den Tag. Mit Tagesanbruch schlichen sie weiter auf ihrem Pirschgange, den Budetälern zu. Jetzt waren sie, einer hinter dem anderen hergehend, auf einem nicht mehr gangbaren, verwachsenen Fahrweg im Forstort Wildsteig. Da, wo dieser Weg eine Strecke in gerader Linie fortgeht, und sich nach einer lichteren Stelle des schon hochgewachsenen Unterholzes öffnet, erschallte ihnen plötzlich der furchtbare Ruf „Halt, steh Kanaille!“ entgegen.
„Da hat der Teufel die Jäger!“ schrie Ziegle und sprang rechts ab. Löhning hatte in demselben Augenblick die Flucht nach der anderen Seite hin ergriffen.
Ziegler lief in furchtbarer angst erst in dem offenen Wege am Berghang hinunter, dann wand er sich nach rechts, um den jungen Stangenort am steilen Abhang des Budethals zu erreichen. Unten lag Treseburg. Dort wäre er gerettet gewesen, aber mit ihn einholender Schnelligkeit war ihm der Jäger Stöcker auf den Fersen gefolgt. Die dichten Stangen des jungen Aufschlags hemmten den Lauf des Wilddiebes. Seine Büchse trug er vor sich, den Hahn gespannt, was aber der ihn verfolgende Jäger nicht sehen konnte.
Plötzlich wendete sich der Verfolgte um. Noch war der Jäger zwei Schritte von ihm entfernt, da drückte er ab. Die Kugel schlug in nächster Nähe durch den unterleib des Jägers. Dieser, ohne seine schwer empfangene Todeswunde in diesem augenblick zu bemerken, ergriff den Wilddieb beim Kragen und jetzt begann ein kurzer, aber furchtbarer Kampf zwischen einem sterbenden Wehrlosen, der mit der letzten krampfhaft angestrengten Kraft, schon vom klaren Selbstbewußtsein verlassen, seinen Mörder festhält und nicht von ihm abläßt, obwohl dieser, um sich aus den Händen des Halbtoten loszuwinden, sein Waidmesser zieht, und es dem Jäger zwei Mal bis ans Heft in den Leib stößt, und ihm noch zwei tiefe Wunden am Kopf beibringt.
So steht der Kampf zwischen beiden. Der Eine ringend mit der Verzweiflung, der Andere mit dem Tode. Da sprang der Fußjäger Hennings herbei, der sich nur einige Augenblicke mit der Verfolgung des Löhning aufgehalten hatte, und gab dem Mörder mit dem Kolben seines Karabiners einen Stoß vor die brust, so dass dieser zurücktaumelte.
Der Sterbende sank in sich selbst zusammen, und mit brechenden Augen seinen Genossen erkennend, rief er diesem zu: „Bruder, ich muß sterben! Stich mich nur tot!“
Jetzt aber begann ein zweiter Kampf, von der Seite des Wilddiebes mit der Wut der Verzweiflung, von Seiten des Fußjägers mit Besonnenheit und Mäßigung geführt. Der Wilddieb raffte sich auch und stach nach dem Jäger, aber dieser begegnete dem Messerstich, der kaum seine Haut streifte, mit einem hieb mit dem Hirschfänger. An der rechten Hand des Wilddiebes hieb er den Zeigefinger ab und beschädigte den zweiten Finger stark. Das Messer entfiel der verwundeten Hand des Mörders, aber mit der linken ergreift es der Wütende wieder und stach abermals auf den Jäger ein. Dieser verteidigte sich mit dem Hirschfänger, schlug ihn zum zweiten Mal das Messer aus der Hand, indem er ihn am Nacken und am Knie verwundete, und warf den Entwaffneten zu Boden nieder.
„Christian hilf!“ rief der Wilddieb. Vergebens sah Hennings sich nach den Seinigen um. In jedem Augenblick mußte er fürchten, dass aus der nahen Dickung des Waldes ringsumher Schüsse von anderen Wilddieben auf ihn fallen, aber besonnen und treu in seinem Beruf floh er nicht, sondern hielt den Wildschütz durch einen Fußtritt auf der Brust am Boden fest, während er die Büchse des gefallenen Jägers ergreift und deren Lauf, nach allen Seiten wendend, schussfertig hielt.
Endlich erschien der Jäger Bodenstein, später kamen auch der Förster Küchler und Jäger Krebs herbei. Als aber letztere beiden voll Unwillen über die ihr Gefühl empörende Tat anfingen, den schwerverwundeten Wilddieb zu mißhandeln, wurde Hennings mit großherziger Mäßigung der Verteidiger desjenigen, der soeben seinen Freund getötet und ihm selbst nach dem Leben getrachtet hatte.
Der Jäger Stöcker starb wenige stunden später. Der brennende Pfropf aus der Büchse des Wilddiebes hatte ihm seine Jagdbluse und den Leib an der stelle des Anschusses verbrennt. Diese Schußwunde und jeder der drei Messerstiche in den Leib waren absolut tödlich.
Es gehört nicht hierher, die verschiedenen Kombinationen anzudeuten, wodurch der abweichenden und variierenden Aussage des Wilddiebes ungeachtet, der Tatbestand der absichtlichen Tötung festgestellt wurde. Notwehr von Seiten des Wildschützen war nicht vorhanden, denn er ging auf unerlaubten Wegen und war auf keine seinem Leben Gefahr drohende Weise verfolgt und angegriffen worden.
Der Wilddieb Ziegler wurde in beiden Instanzen zur Strafe des Schwertes verurteilt. Geistlichen Zuspruch hat er sich verbeten, aber um die Gnade des durchlauchtigsten Landesherrn nachgesucht.
Beiden Verbrechern wurde keine Begnadigung zu Teil, jedoch gewannen beide eine ganz unbegreifliche sanguinische Lebenshoffnung. Die abschlägige höchste Resolution wurde beiden an einem Tag eröffnet. Doch war es schwer, besonders Ziegler begreiflich zu machen, dass er von jetzt an keine Hoffnung mehr für das Leben habe. Die Glahn ergab sich mit Ruhe und Vernunft in ihr Schicksal und verlangte einen Beichtvater, zu dem sie Zutrauen gefaßt hatte, um das heilige Abendmahl zu empfangen.
Keine Spur von Geistesverwirrung war an ihr wieder wahrzunehmen, seitdem mit richtiger Menschenkenntnis ihr das einsame, für sie so sinnverwirrende Gefängnis, unter gehöriger Aufsicht, in einen mehr für sie beschäftigenden Verkehr verwandelt worden war. Es war seit den Tagen ihrer Jugend vielleicht das erste Mal, daß sie das ruhige Bürgerliche Familienleben aus der Nähe zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte. Das humane und doch sehr vorsichtige Benehmen des Gefangenenwärters und seiner Frau schien tiefen Eindruck auf sie zu machen. Es schien, als sei ihr das ganze Gemüt umgewandelt worden, in wahrer, Gott ergebener Reue.
Dem Mörder Ziegler konnte den Umständen nach nicht jene wohltätige Beschäftigung gegeben werden. Er blieb daher auch verschlossener, zeigte häufig Spuren eines sehr bösartigen Gemüts, betete viel, aber nur als Heuchler, indem er alle Sprüche, die er auswendig wußte, gerade umgekehrt anwendete, schimpfte und fluchte auf alle die, die ihn, nach seiner Meinung, in`s Verderben gestürzt hatten. Nahm zwar am Tag der Hinrichtung das heilige Abendmahl, glaubte aber immer noch an Begnadigung. Erst in der letzten Nacht, die er mit einem einfachen Landmann seiner früheren Bekanntschaft, der als Wache bei ihm war, betend zubrachte, schien ihm der harte Sinn erweicht zu sein.
Am 1. Dezember, Morgens halb neun Uhr, bestiegen beide Delinquenten den Wagen, der sie zur Richtstätte führen sollte. Unter dem Läuten des Armensünderglöckchens, unter Begleitung eines Detaschements Landwehrdragoner und einer zahllosen Menschenmenge fuhren sie gefesselt vor das Rathaus.
Hier war die Schützengilde en haie aufgestellt. Im Gerichtssaal wurden ihnen nochmals das Urteil eröffnet. Sie wurden über den, in kurzen Fragen gestellten Tatbestand, nochmals öffentlich vernommen, sodann feierlich dem Scharfrichter übergeben, mit der Anweisung, gut und ohne Verlängerung der Qual, beide mit dem Schwert zu enthaupten.
Der Tatbestand ihrer Verbrechen in kurzen Punkten aufgestellt, wurde gedruckt verteilt, als ein öffentliches Zeugnis der Obrigkeit über die Rechtmäßigkeit der nachfolgenden blutigen Schauspiels. Kein Stab wurde gebrochen, kein Zetergeschrei erhoben, keine Stühle und Tische wurden umgekippt, wie es der alte Gebrauch eines hochnotpeinlichen Halsgerichtes sonst mit sich brachte. Das war ein ebenso feiner, wie ehrender Zug für die mit der Leitung der Exekution beauftragten Richter, daß sie alles vermieden, was nach der Aufklärung unserer Zeit als lächerlich erscheinen und störend hätte wirken müssen.
Kein Prediger begleitete die Delinquenten zur Richtstätte. Denn es ist ein wahrer Unsinn, zu glauben, daß noch auf dem letzten Todesgang, unter dem Geräusch einer zahllosen Menschenmenge, der Verbrecher, auf den viele Tausend Augen sehen, unter dem Zuspruch eines Geistlichen, mit wahrer echter Reue in sich selbst einkehren werde, und etwas anderes empfinden könne, als Seelenangst vor dem nahen schrecklichen Ende oder jene stumme Verzweiflung, die in eine völlige Seelenlosigkeit übergegangen zu sein scheint. Wer seinen Gott nicht in der Ruhe des Gemüts erkannt hat, wird ihn auch nicht unter einem so vernichtenden Zusammenströmen der störendsten Umstände erkennen.
Der Zug mit den Delinquenten ging die sogenannte Tränkestraße hinab, aus dem Tränketor hinaus. Denselben Weg fuhr der Scharfrichter Glaser aus Halberstadt, vor dem Wagen der Delinquenten her. Es konnte ihm von einigen als Ostentation (???) ausgelegt werden, daß er einen Postzug Schimmel, lang gespannt, vor seinem Wagen hatte. Wenn man aber bedenkt, dass bei der Seltenheit solcher Exekutionen in der Meinung des Volkes das Amt des Scharfrichters immer hin und wieder mit dem Amt des Nachrichters verwechselt, und mindestens von diesem auf jenen eine kleine Anrüchigkeit übertragen wird, so war es nicht nur zu entschuldigen, sondern gewissermaßen notwendig, daß dieser Mann sich in einer äußeren Haltung zeigte, die noch am ehesten geeignet war, jene Nebenidee in der Meinung des großen Haufens zu beseitigen, und dadurch der Exekution selbst mehr Würde und Ernst zu verleihen.
Er war einfach schwarz gekleidet, trug nicht den sonst üblichen blutroten Scharfrichtermantel, und sein breites, sechs Fuß langes hellpoliertes Schwert steckte nicht in einer Scheide, sondern lag wie ein chirurgisches Instrument in einem Klappfutteral.
Zwei deputierte Beamte fuhren einen anderen Weg zum Richtplatz, der in einer Niederung auf dem Weg nach Börnecke so zweckmäßig angelegt war, daß von allen Seiten her an 30.000 Menschen ohne alles Gedränge zuschauen konnten. Das Schaffot war sechs Fuß hoch von Rasen erhöht. Rings umher lag ein breiter Graben, in dem eine Wagenburg befindlich war. Diese war mit Bauern aus dem Amt Blankenburg besetzt und ringsum hielten die Landdragoner eine musterhafte Ordnung.
Ziegler wurde zuerst auf das Schaffot geführt. Er sah sich noch einmal um, dann setzte er sich nieder auf den für die Enthauptung bestimmten Stuhl. Es war eine wohl notwendige, aber doch die Qual des Unglücklichen etwas verlängernde Maßregel, daß ihm, nachdem ihm die Augen verbunden waren, eine Art Halfter angeschnallt wurde, mit einem Knopf oben auf der Mitte des Kopfes, woran der Nachrichtersknecht den Kopf während des Hiebes hoch halten konnte. Das geschah jetzt.
Der zweite Knecht übergab dem Scharfrichter das Schwert. Dieser faßte es mit beiden Händen, und mit Blitzesschnelligkeit war der Kopf vom Rumpf getrennt.
Es war wieder ein feiner Zug, der Erwähnung verdient, daß der Scharfrichter keinen Blick auf den Enthaupteten zurückwarf, sondern sich abwendete und schweigend seinen Gehilfen das blutige Schwert wieder hinreichte.
Halbtot und erstarrt wurde sie mehr auf das Schaffot getragen als geführt. Zieglers Leiche wurde schon in den Sarg gelegt. Jetzt wurde auch ihr die Binde und das Riemenwerk angelegt, aber eine Schnalle hatte sich durch die Unachtsamkeit des zweiten Knechtes gelöst. Es bedurfte daher eines schnellen, kurzen Nachhiebes, um den Kopf der Glahn völlig vom Rumpf zu trennen.
Jetzt erst erfolgte auf die Frage des Scharfrichters: „Habe ich wohl gerichtet, meine Herren?“ das laute „Bravo!“
Aber man würde sich irren, wenn man diesen Ausruf für den Jubel der Schadenfreude hätte halten wollen. Das Volk, welches zum Teil mit aus Pöbel der nächsten Grenzstädte bestand, bewies eine Erschütterung, eine Ruhe und Ordnung, welche recht klar zu erkennen gab, daß diese Exekution ihren höchsten Strafzweck, die Abschreckung, wenn nicht erreicht, so doch im hohen Grad befördert hatte.