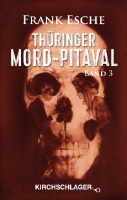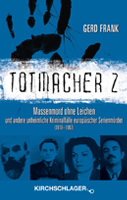Man schlug in den Polizeiakten nach. Troachi Soejima war der Polizei nicht unbekannt. Am 31. Juli 1919 hatte man ihn festgenommen. Er hatte auf einem im East River liegenden Schlepper, auf dem er als Heizer beschäftigt war, ein anderes Mitglied der Besatzung, einen Russen, im Streit erschlagen. Vor Gericht spielte Soejima den Geschworenen eine Komödie vor. Er wußte sich als schüchternes, hilfloses Menschenkind darzustellen, das von dem Russen so lange gequält und brutalisiert worden sei, bis ihm eines Tages die Geduld riß. Die Geschworenen gingen ihm auf den Leim und sprachen ihn frei, weil er sich in Notwehr befunden habe. Hätte das Gericht etwas von Soejimas Vergangenheit gewußt, so wäre der Wahrspruch wohl anders ausgefallen. Er durfte es nicht wagen, einen der Staaten östlich des Missouri zu betreten. Seine eigenen Landsleute hatten ihn in Acht und Bann getan und ihm die schlimmsten Torturen in Aussicht gestellt, wenn er sich je bei ihnen blicken lasse.
Nach Japan zurückzukehren, durte er ebenfalls nicht wagen, weil er sich auch ins einer Heimat eines Totschlags schuldig gemacht hatte, der noch ungesühnt war. Es gab in den Städten des Ostens einen Falschspielertrust, der die Spielhöllen in den Chinesenvierteln kontrollierte. Die Organisation stand unterd er Leitung eines Mannes, dessen rechte Hand angeblich Soejima war. Die Bande hatte eine Anzahl ihrer Gegner aus dem wege räumen lassen. Angeblich sollte Soejima all diese Bluttaten auf dem Kerbholz haben. Ein Teil der Ermittlungen muß an dieser stelle übergangen werden, da sonst die Darstellung zu breit würde. Genug, daß die Kriminalpolizei verschiedenen Spuren nachging und dabei eine Menge Material zutage förderte. Zur Herbeischaffung des geflohenen Soejima konnte es zwar nicht dienen, erwies sich aber später noch als außerordentlich nützlich.
Eine Beschreibung und die Fingerabdrücke des Gesuchten waren selbstverständlich an alle Polizeiverwaltungen Amerikas gesandt worden. Insbesondere machte man die Behörden im Westen auf Troachi Soejima aufmerksam. War er doch im Osten so verhaßt, daß er dort mit größter Wahrscheinlichkeit keine Zuflucht finden konnte.
Cavanaugh hatte seine eigene Ansicht darüber, wo der Totschläger zu suchen sei. Wenn Soejima einer Unterweltorganisation angehörte, so war anzunehmen, daß die Bande auch das Geld beschaffen würde, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Das erforderte aber Zeit, und bis das Geld gesammelt war, mußte sich Troachi irgendwo in der Stadt verborgen halten. Wer aber war bereit, dem Ausgestoßenen, der mindestens ebenso verhaßt war wie der Mann, den er getötet hatte, Schutz und Zuflucht zu gewähren? Cavanaugh erinnerte sich, daß Hiroshi vor gar nicht langer Zeit einem Landsmann einen heimtückischen Messerstich versetzt hatte. Das Opfer hieß Kunjara. Und Kunjara war der einzige, der ein Interesse daran besaß, den Mann zu schützen, der ihn an Hiroshi gerächt hatte. Kunjara wohnte in der Mott Street Nr. 22. Es war vielleicht nützlich, das Haus im Auge zu behalten. Mit seinem Freund Cashman zusammen promenierte Cavanaugh in der Mott street auf und ab. Aber der Ausflug blieb ergebnislos.
Kurz nach Mittag kehrten die beiden Beamten enttäuscht auf das Polizeirevier in der Elisabeth Street zurück. Kaum aber saßen sie wieder hinter ihrem Schreibtisch, als das Telephon klingelte: Herr Fu meldete sich und bat die beiden Freunde, ihn vor einem Blumenladen Ecke der 8. Avenue und der 34. Straße zu treffen.
Sie brachen sofort aus. In einer halben Stunde hatte die Untergrundbahn sie an Ort und Stelle gebracht. Vor dem Schaufenster des Blumengeschäfts stand, ind en Anblick der Blumenpracht vertieft, ein Herr, in tadelloser, aber unauffälliger europäischer Kleidung. Seine Züge wiesen fast nichts auf, was an seine asiatische Abkunft erinnerte.
Kaum hatte er mit einem flüchtigen Seitenblick die beiden Beamten erspäht, als er sich gemütlich schlendernd in Bewegung setzte, in die 35. Straße einbog, und dem Hochbahnhof in der 9. Straße zustrebte. Auf halbem Wege erst blieb er stehen und gab dem Kriminalbeamten ein Zeichen, heranzukommen.
Mister Fu sprach ein sauberes Englisch. Er erwähnte, daß er die Beamten vor dem Hause in der Mott Street Nr. 22 gesehen habe. Er habe sofort erraten, was sie dorthin führte. Soejima halte sich in dem Gebäude versteckt. Er sei direkt nach dem Mord dorthin geflohen. Der Freund, bei dem er wohnte, habe ihn verborgen, bis die 500 Dollar zusammengebracht waren, die man Soejima zur Verfügung stellte, damit er außer Landes fliehen könne. Das Geld war Soejima bereits ausgezahlt worden. Er hatte es jedoch vorgezogen, einstweilen nur bis in den Vorort Harlem zu fahren, wo es ein verrufenes Haus gab, das sich seiner Gunst erfreute. Die Adresse des Etablissements behauptete Fu nicht zu kennen, versprach aber, sich darum zu bemühen.
Damit war die Unterhaltung zu Ende. Herr Fu empfing das „Honorar“, ohne das man nicht auf seine Dienste rechnen konnte, und die Kriminalbeamten machten sich auf den Rückweg zur 34. Straße.
Es ist vielleicht nicht uninteressant zu erwähnen, daß derartige Dienstleistungen von den Beamten aus eigener Tasche bezahlt werden müssen und der Behörde nicht als Spesen in Rechnung gestellt werden dürfen. Wenn also ein Beamter ehrgeizig ist, so muß er auch dafür bluten.
„Ein widerwärtiger Kerl!“ knurrte Cavanaugh mit allen Anzeichen des Abscheus. „Er weiß natürlich ganz genau Bescheid, aber er ‚streckt‚ seine Informationen, um uns mehr Geld abzuluchsen.“
In der Folgezeit ließ Herr Fu noch zwei oder dreimal von sich hören. Jedes „Rendezvous„ mit ihm kostete natürlich Geld. Je magerer seien Informationen wurden, desto höher waren die Preise, die er forderte.
„Vielleicht bilde ich es mir nur ein“, bemerkte Cashman eines Tages nach einem erneuten Zusammentreffen, „aber dein Freund Fu macht mir einen etwas merkwürdigen Eindruck. Hat er vielleicht Opium geraucht?“
„Das ist auch nicht ausgeschlossen“, erwiderte Cavanaugh langsam und nachdenklich. „Aber ich will dir sagen, was mir aufgefallen ist. Jedesmal, wenn wir einem Fingerzeig nachgehen, den wir Herrn Fu verdanken, stolpern wir über unsere lieben Kollegen Donahue und Martin. Es könnte nicht schaden, wenn wir Herrn Fu, sobald er das nächstemal anruft, jemanden von unseren Leuten auf die Fersen setzen, ohne daß er es weiß!“
Gesagt. Getan. Der Spitzel wurde von einem anderen Beamten unauffällig beobachtet, und es zeigte sich, daß Herr Fu seine Informationen an zwei Stellen verkaufte und dementsprechend daran auch doppelt verdiente. Er hatte übrigens dem polizeilichen „Schatten“, der ihm folgte, das Leben nicht leicht gemacht. Aus seinem ganzen Benehmen ging hervor, daß er mit der Möglichkeit einer Überwachung rechnete. Erst nach endlosen Irrgängen und Winkelzügen verschwand er in einem Haus am River Side Drive. Nachfragen ergaben, daß er dort wohnte.
Nach Fus letzten Mitteilungen war Soejima bereits nach Washington abgefahren und wollte von dort aus weiter nach Oregon und Kalifornien, wo es große Japaner-Kolonien gibt. Sein endgültiges Ziel war, wie es hieß, Mexiko.
Die Zeit verging. Cavanaugh und sein Kollege Cashman hatten mit neueren und dringenderen Fällen zu tun. Der Mord in Chinatown trat etwas in den Hintergrund, ja, er schien vergessen. Von Zeit zu Zeit aber fuhren die beiden Beamten immer noch nach Harlem und drückten sich in der Nähe der verrufenen Lokale herum, die hauptsächlich von Farbigen besucht werden.
Eines Abends sah Cavanaugh ein Straßenmädchen, das er von einer früheren Gelegenheit her kannte. Sie war von ihm bei einer Haussuchung in Chinatown in einem Absteigequartier festgenommen worden. In diesem Augenblick tauchte sie aus einem der nicht allgemein zugänglichen Tanzlokale auf und verschwand gleich darauf auf der anderen Seite der Straße in einem anderen Haus, das der Polizei schon seit langem als verdächtig galt. Cavanaugh entschloß sich, mit seinem Kollegen auf ihre Rückkehr zu warten. Es ging gegen Morgen, die Straßen lagen verlassen, nur hie und da war noch ein vereinsamter Nachtbummler zu sehen, als das Mädchen wieder die Straße betrat. Die beiden Beamten gingen ihr nach und stellten sie im Lichtkreis einer hellen Bogenlampe. Herausfordernd starrte sie den beiden Männern ins Gesicht. Ihre Züge zeigten noch die letzte Spur der Jugend, waren aber vom Trunk verwüstet. Sie schien gleich erraten zu haben, daß die beiden nicht etwa Lust hatten mit ihr anzubändeln, sondern daß sie Polizisten waren.
Als Cavanaugh sie einlud, in einer Imbißhalle in der Nähe, die die ganze Nacht geöffnet war, eine Tasse Kaffee mit ihnen zu trinken, erklärte sie sich achselzuckend dazu bereit.
„Ihr gebt euer Geld umsonst aus“, meinte sie schnippisch. „Ich hab nichts auf dem Kerbholz und deshalb könnt ihr auch nichts aus mir herausbekommen.“
Aber es zeigte sich, daß die Beamten ihr Geld nicht umsonst ausgegeben hatten. „Maisie“ kannte nicht nur Troachi Soejima, sondern sie war auch ohne weiteres bereit, auszupacken, was sie über ihn wußte.
Sie trank zwei tassen starken schwarzen Kaffee, paffte eine Zigarette und sah durch den blauen Zigarettenrauch hindurch die beiden Beamten herausfordernd an.
„Und ob ich jimmy kenne!“ sagte sie. (Sie hatte sich den fremdländischen Namen nach ihrer Manier zurechtgemacht.) „Das ist ein hundsgemeiner Kerl!“
Sie schnitt eine Grimasse. „Heute abend erst hab ich jemanden gesprochen, der Jimmy in Denver gesehen hat. Er denkt, er kann dort große Gelder einheimsen. Der Idiot soll sich nur keine Hoffnungen machen. Man führt ihn dort bloß an der Nase herum – ich weiß nicht, worauf`s hinauslaufen soll, aber ich hoffe, es endet damit, daß sie Jimmy lebendig in Öl sieden oder ihm sonst etwas antun, was schlimmer ist, als man sich`s ausdenken könnte.“
Daran knüpfte sich ein langes Gespräch, aber e szeigte isch bald, daß Maisie nicht mehr wußte. Sie gab den Beamten ihre Adresse und erklärte, wenn sie ihnen helfen könne, den Kerl dingfest zu machen, sei sie dazu mit Freuden bereit. Sie habe nichts gegen die Polizei, und sie fürchtete sich auch nicht vor der Rache der Gelben.
Noch im Laufe des Vormittags, es war der 13. April, telegraphierten die Kriminalbeamten an die Polizei in Denver und wiesen darauf hin, daß Soejima sich zur Zeit dort aufhalte. Die Polizei in Denver antwortete, es bestehe eine große Kolonie von Japanern in einem Orte der Umgebung von Denver, und es sei vielleicht zu empfehlen, Photographien des Gesuchten in hinreichender Anzahl an den Sheriff des Ortes zu übermitteln. Dies geschah. Wieder kam die Untersuchung nicht recht voran. Am 19. April aber traf ein Polizeitelegramm aus Denver ein.
„Troachi Soejima hier festgenommen, versuchte gefälschte Banknoten in Verkehr zu bringen.“
Sofort ging telegraphisch die Aufforderung nach Denver, den Verhafteten unter keinen Umständen wieder auf freien Fuß zu setzen, da er von New York aus wegen Mordes gesucht werde. Mit dem nächsten Zug wurden die Kriminalwachtmeister Donahue und Martin nach Denver geschickt. Man zeigte ihnen Troachi in einer Zelle des Arrestlokals. Er war streitsüchtig, trotzig und fürchterlich verschmutzt. Ein Bad schien dringend notwendig. Und die beiden Beamten waren fest entschlossen, ihm diese Wohltat angedeihen zu lassen. Es stand ihnen das Vergnügen bevor, auf der Rückreise lange Stunden in einem engen Kupee verbringen zu müssen, und es war nicht auszudenken, welche Überraschungen seine Lumpen womöglich noch bargen.
Das das Arrestlokal keine Waschgelegenheit besaß, begaben sich Donahue und Martin mit ihrem Häftling auf die gleich nebenan liegende Feuerwehrwache und befahlen ihm, sich zu entkleiden.
Während er seine Lumpen ablegte, kamen Donahue und Martin mit dem Kommandanten der Feuerwehrwache, Heally ins Gespräch. Es stellte sich heraus, daß Heally und Donahue aus demselben Viertel von Brooklyn stammten. Der Brandmeister war begeistert: „Ich werde den Kerl für euch waschen!“ erklärte er, nachdem er das Neueste aus seiner Vaterstadt gehört hatte. „Stellt ihn da gegen die Wand und ich werde seine Schmutzkruste im Handumdrehen herunter haben.“
Damit bückte er sich nach einem Stahlrohr größeren Kalibers. Zufällig warf Martin im letzten Moment noch einen Blick auf seinen Gefangenen: „Halt!“ brüllte er. Troachi war gelbgrün im Gesicht. In seinen Augen funkelte der Wahnsinn. Er zitterte an allen Gliedern. Der Unterkiefer hing ihm schlaff herab.
„Was ist denn bloß los?“ fragte Heally verwundert.
„Sehen Sie denn nicht? Der Kerl ist ja außer sich vor Todesangst!“ erwiderte Martin. „Ich wette, er bildet sich ein, wir hätten uns für ihn eine neue Art von Wasserfolter ausgedacht. Sein Verteidiger wird sich der Sache später annehmen und wir werden tausend Scherereien haben.“
Soejima verstand nur wenig englisch. Deshalb versuchte man ihn durch Gebärden begreiflich zu machen, weshalb man ihn zur Feuerwehr gebracht hatte. Froh, der drohenden Gefahr entronnen zu sein, ging er stürmisch auf alles ein: „Gib mich! Gib mich!“ grinste er. „Ich mich waschen selbst.“
Der Brandmeister trieb irgendwo einen Rest Schmierseife auf und Soejima machte sich mit Feuereifer an die Arbeit. Auch als man ihm eine Kanne Petroleum reichte, mit der Aufforderung, damit dem Getier in seinem schwarzen Haar zu Leibe zu rücken, zuckte er nicht mit der Wimper.
Ein Dolmetscher wurde beschafft und man begann die erste Vernehmung. Nach allem, was die Beamten hörten, war Soejimas Weg auf der Flucht nicht gerade mit Blumen bestreut gewesen. Überall war er auf Todfeinde gestoßen. Man hatte ihn von Stadt zu Stadt gehetzt. Erst in Denver fand er sich etwas besser aufgenommen. Er hatte mit ein paar Chinesen Freundschaft geschlossen, die sich zunächst als recht liebenswürdig erwiesen. Sie erklärten ihm, er, als Fremder, könne ihnen sehr nützlich sein. Es sei ihnen eben gerade ein großer Einbruch geglückt. Ob er sich ihnen anschließen wolle. Soejima, der nicht recht ein noch aus wußte, sagte zu. Man verlangte von ihm nur einen kleinen Freundschaftsdienst: nämlich, in eine Bank zu gehen und einen Zwanzigdollarschein zu wechseln. Die Polizei halte Ausschau nach zwei Chinesen, wurde ihm erklärt, aber ein Japaner errege sicher keinen Verdacht. Wenn das Geld gewechselt sei, könne man ihm auch soviel geben, daß er sich halbwegs anständige Kleider kaufen könne.
Soejima war ohne weiteres dazu bereit. Das war doch eine Kleinigkeit! Er betrat die Bank und schob dem Kassierer den Schein zum Wechseln hin. Im nächsten Augenblick schon zappelte er in den Händen des Bankdetektivs.
„Sonderbar ist an der ganzen Geschichte“, berichtete der Polizeichef von Denver, der dem Verhör beiwohnte, „daß die Bank durch einen anonymen Telephonanruf aufmerksam gemacht worden ist. Der Anrufende warnte die Bankangestellten ausdrücklich vor einem Japaner, der versuche, gefälschte Banknoten in Umlauf zu setzen. Und die angeblich gestohlene Banknote, die Soejima von seinen chinesischen Freunden erhalten hatte, war tatsächlich gefälscht. Kaum hatten wir ihn hinter Schloß und Riegel, als auch wir von einem Unbekannten angerufen wurden, der uns darauf hinwies, daß der Verhaftete von der New Yorker Polizei wegen Mordes gesucht werde.“
Es vergingen ein paar Tage, bis alle Förmlichkeiten erledigt waren und die New Yorker Beamten mit ihrem Häftling die Rückreise antreten konnten. Soejima hatte inzwischen seine Fassung wiedergewonnen. Er leugnete energisch, Hiroshi umgebracht zu haben.
„Wer das sagen, lügen!“ erklärte er.
Um ihm ein wenig Stoff zum Nachdenken zu geben, ließen die Beamten den einen oder anderen Hinweis auf Dinge fallen, die sich im Laufe der Untersuchung herausgestellt hatten. Es waren zum Teil intime Details und sie bildeten recht wichtige Fäden in dem Gewebe des Schuldbeweises gegen den Verhafteten.
Es geschah, was sie erwartet hatten. Ihr wissen um diese für einen Außenstehenden anscheinend so unwesentlichen Kleinigkeiten, begann dem Japaner heftige Kopfschmerzen zu verursachen. Wer hatte ihn verraten? Und wieviel war ausgeplaudert worden?
Auf alle Fälle versuchte er seine Darstellung des blutigen Auftritts darzustellen.
„Hiroshi böses Schuft gewesen sein“, winselte er mit einem Lächeln, das er so gewinnend wie möglich zu gestalten versuchte. „Alle hassen Hiroshi. Hiroshi versuchen wollen, auf Soejima zu schießen. Ich ihm abnehmen will Revolver. Revolver geht los …“
Aber Martin und Donahue zogen ein skeptisches Gesicht und ließen ihn nicht weiterreden. Hiroshi hatte mit dem Messer „gearbeitet“, niemals mit dem Revolver!
Als der Zug in New York einlief, wurde Soejima sofort von dem Leiter des Morddezernats und vom Staatsanwalt vernommen. Er war gerade „reif“ zu zu einem Geständnis. Ein Dolmetscher und ein Stenograph waren schon hinzugezogen. Natürlich bestritt er, mit Vorbedacht gehandelt zu haben, aber er gab wenigstens zu, Hiroshi nach einem beim Spiel entstandenen Streit getötet zu haben. Das genügte, um ihn vor Gericht zu stellen, und man gab es auf, ihm den Vorbedacht nachzuweisen, da es unter den obwaltenden Umständen wahrscheinlich doch nicht gelungen wäre. Er wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt, mit der Maßgabe, daß nach Verbüßung von zwanzig Jahren Bewährungsfrist eintreten könne. Sein Aufenthalt in Sing-Sing währte alledings nur kurze Zeit. Die anderen Gefangenen hielten ihn dauernd zum besten. Sie redeten ihm ein, der Richter habe ihn bei der Verkündung des Urteils hinters Licht geführt, und eines Nachts werde man ihn plötzlich am Kragen packen und zum elektrischen Stuhl schleifen. Er glaubte alles aufs Wort und nahm es sich so zu Herzen, daß er tobsüchtig wurde. Man mußte ihn der Anstalt für geisteskranke Sträflinge in Dannemora überweisen, wo er jetzt noch lebt.
Sakai war bis zur Erledigung des Prozesses in Schutzhaft geblieben. Er legte eine geradezu wahnwitzige Furcht an den Tag und erklärte, daß es um ihn geschen sei, sobald man ihn wieder freilassen werde. Wenn er auch nur unter dem Zwang der Polizei bei der Untersuchung des Falles Hilfe geleistet habe, so werde das die japanischen Banditen, zu denen der Verurteilte gehörte, nicht hindern, ihn eines Tages kalt zu machen. Seine einzige Hoffnung sei es, irgendwie heimlich nach China zu verschwinden. Seine Furcht war nicht geheuchelt, und es fiel niemandem ein, ihre Aufrichtigkeit anzuzweifeln. Die Polizei war ihm insofern behilflich, als sie ihm und seiner Familie in aller Öffentlichkeit Fahrkarten nach Kalifornien besorgen ließ. In aller Stille jedoch belegte man für ihn Plätze auf einem Schiff, das nach China auslief. Als man ihn wohlbehalten auf hoher See wußte, wurden die Billetts nach Kalifornien zurückgegeben.
Herr Fu hielt es für geraten, aus New York zu verschwinden. Es hatte den Anschein, als habe er überhaupt den Vereinigten Staaten den Rücken gekehrt.
Der angebliche Chef des Falschspielkonzerns ist nie ermittelt worden. Auch so ist die Polizei mit dem Erreichten zufrieden, denn unmittelbar nach dem Tode Hiroshis hörten die Bluttaten, die sich vorher gehäuft hatten, mit einem Schlag auf.
Ein rätselhafter Umstand konnte nie geklärt werden: Warum der chinesische Teil der buntfarbigen Unterwelt von Chinatown sich mit solchem Eifer an der Verfolgung Soejimas beteiligt hatte; denn es kann kein Zweifel bestehen, daß man ihn zu guter Letzt der Polizei absichtlich in die Hände spielte. Leute, die Bescheid wissen, meinen, es sei die Rache dafür gewesen, daß ein japanischer Bandit sich ein chinesisches Lokal zum Schauplatz seiner Tätigkeit erkor – das ist jedenfalls nichts weiter als eine Theorie. Was wirklich die Chinesen veranlaßt haben kann, von einer jahrzehntelang befolgten Regel abzuweichen und der Polizei der Weißen Hilfestellung zu leisten, wird wohl nie zu ermitteln sein.
Quelle: J. Brand: Auf der Mörderjagd im New Yorker Chinesenviertel. In: Wahre Detektiv Geschichten, 2. Jahrgang, Nummer 4, 20. April 1931, S. 1-10 u. S. 60-63 (Sammlung Kirchschlager, Arnstadt).