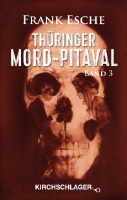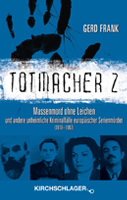Chinatown, New York: Gewundene, enge Straßen, Geschäfte voll seltsamer Kuriositäten, prunkende Restaurants, die als Sehenswürdigkeit auch von den Weißen besucht werden, und kleine Spelunken. Eine Stadt der Gegensätze. In verwahrlosten alten Baracken stößt man plötzlich auf üppig eingerichtete Liebesnester. Tief unter der Erde brodelt das fieberhafte Leben der Spielhöllen. Und nicht weniger pittoresk sind die Menschen, die die seltsame Szene bevölkern. Söhne des Himmels in ihrer alten Tracht oder in europäischer Kleidung, Weiße, vom Schicksal in die Chinesenstadt verschlagen, die sie nicht wieder losläßt, meistens Opfer des Opiums. Hier findet sich alles, was man sich für das blutrünstigste Filmdrama nur wünschen kann: der Hintergrund, die Versatzstücke und die Typen.
Freilich, die Polizeibeamten, denen das Wohl und Wehe Chinatowns anvertraut ist, meinen schmunzelnd, es gehe in ihrem Viertel doch nicht ganz so wild zu, wie im Film. Bisweilen allerdings findet sich ein Fall, bei dem die Wirklichkeit alle Schöpfungen der Phantasie übertrifft. Und mit einem solchen Fall wollen wir uns hier beschäftigen.
In den Tagen, als die Polizei sich noch über diese Angelegenheit Sorgen machte, wurde alles, was damit zusammenhing, sorgfältig vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, um die Einschüchterung von Zeugen und das Ausbrechen eines erbitterten Rachefeldzuges zwischen den verschiedenen Klüngeln und Gruppen der chinesischen Bevölkerung von vornherein zu vermeiden.
Alles, was hungrige Reporteraugen je davon zu sehen bekamen, war eine Eintragung im Dienstagebuch des Polizeireviers Elisabeth Street in New York unter dem Datum des 21. März 1921. Sie lautete: „Mord. Opfer unbekannt. Japanischer Herkunft. Aufgefunden: Chatan Square Nr. 10. Tod verursacht durch Schußwunde. Meldung erfolgte durch Kriminalwachtmeister Cavanaugh und Cashman.“
Das war knappe Kost für die Polizeireporter, kaum der Mühe wert, irgendwo hinten im lokalen Teil eine Zeile darauf zu verschwenden. Gerade in diesen Tagen kam es allzuoft vor, daß man in diesem berüchtigten Viertel von New York eine Leiche von der Straße auflas. Hier strömten ja Namenlose und Schiffbrüchige aus allen vier Weltteilen zusammen, nach denen kein Hahn mehr krähte, wenn sie ein unvorhergesehenes Ende fanden. Gar nicht selten passierte es einem Schutzmann, der seinen nächtlichen Rundgang antrat, daß er plötzlich über die zusammengekauerte Gestalt eines im Sterben liegenden Asiaten stolperte oder unvermutet in die verglasten Augen eines toten „Chinks“ blickte. Seit einiger Zeit kletterten die Ziffern der Mordstatistik mit einer beunruhigenden Ausdauer und Stetigkeit in die Höhe. Was ging vor?
Polizeibeamte, die Chinatown kannten, waren überzeugt, es müsse etwas Besonderes dahinter stecken. Innerhalb der vier Wände der Amtsräume beschäftigte man sich schon lange vor dem Mord im Chatam Quare eingehend mit dem plötzlichen Überhandnehmen von blutigen Verbrechen, obwohl alle Vermutungen über die Ursachen viel zu unbestimmt und verschwommen waren, um sie zum Gegenstand öffentlicher Erörterung zu machen.
Am Chatam Square münden drei Straßen: Doyer Street, Mott Street und Pell Street. Alle drei besitzen einen bösen Leumund. Wer in New York ihre Namen hört, der weiß, daß es sich um eine Ansammlung von Opiumhöhlen, Absteigequartieren und sonstigen Schlupfwinkeln handelt.
„Sieh mal, wieviel Leute vor Goldsteins Laden stehen!“ rief Cavanaugh plötzlich, packte seinen Kollegen am Arm und setzte sich im selben Augenblick in Trab. „Da haben wir ja erst gestern den guten Fang gemacht!“
„Wird wohl wieder einer ausgeplündert worden sein“, knurrte Cashman, als er seine langen Beine in Bewegung setzte.
„Goldsteins Laden“ war ein Zigarren-Schleudergeschäft am Chatam Square Nr. 10. Die beiden Beamten waren schon in nächster Nähe, als die dichtgedrängte Gruppe vor dem Laden sie bemerkte. Ein scharfes Ohr hatte wohl ihre eilenden Schritte gehört. Noch ehe sie an Ort und Stelle eintrafen, war die ganze Gesellschaft auseinandergestoben. Übrig blieb nur ein Botenjunge, der sich von seinem fassungslosen Staunen nicht erholen konnte, ein halbes Dutzend menschlicher Wracks, deren starrer Blick verriet, daß das Rauschgiftlaster längst ihr Hirn gelähmt hatte. Ein Aufgebot von Gassenjungen drückte ihre schmierigen Gesichter gegen die Schaufensterscheibe, um ganz in sich aufzunehmen, was im Innern vorging. Rasch hatten die Beamten sich Bahn gebrochen und betraten das Geschäft. Von dem wüsten Tohuwabohu, das sonst nach solchen blutigen Auftritten zu herrschen pflegt, war hier nichts zu merken. Das einzig Ungewöhnliche war, daß ein Herr in europäischer Kleidung sich in grotesken Verrenkungen auf dem Boden wand und mit hoher Falsettstimme in einer vollkommen unverständlichen Sprache Klagen oder Verwünschungen ausstieß. Die Beamten hielten ihn zunächst für einen Chinesen.
Cavanaugh warf einen Blick auf das Gesicht, dessen gelbe Farbe sich immer rascher zu elfenbeinerner Blässe wandelte, und sah an den schmerzverzerrten Zügen, daß sich der Unbekannte in den letzten Qualen eines geradezu entsetzlichen Todeskampfes wand. Noch ehe er helfend zugreifen konnte, hörte jedoch das Zucken und Umsichschlagen auf. Der Körper reckte sich und schien plötzlich erstarrt. Cavanaugh kniete neben dem Verstummten nieder. Unwillkürlich glitt dabei sein Auge über dessen äußere Erscheinung. Der Anzug war sichtlich nach Maß gearbeitet und saß tadellos. Man hatte es also bestimmt nicht mit einem der vielen namenlosen Vagabunden zu tun, die sich in diesem Viertel herumzutreiben pflegten.
„Der ist hinüber“, sagte er, „scheint Schmuggelwhisky getrunken zu haben, der aus Methylalkohol oder ähnlichem giftigen Zeug zusammengebraut war. Hast du nach dem Rettungswagen telephoniert?“
„Alles besorgt!“ antwortete der Kollege. „Der Wagen muß jede Minute eintreffen. Die Polizeizentrale ist auch benachrichtigt. Es sieht wirklich so aus, als handle sich´s um eine Alkoholvergiftung. Aber es kann natürlich auch anders sein … Weit kann er nicht her sein. Du siehst, er hat weder Hut noch Mantel mit.“
„Was ist hier eigentlich vorgegangen?“ herrschte Cavnaugh den Verkäufer an, der zitternd und leichenblaß hinter dem Ladentisch stand. „Wer ist der Mann da?“ Er deutete auf den Toten.
„Das weiß ich doch nicht!“ antwortete der Verkäufer mit bebender Stimme. „Ich räumte gerade Zigarrenkisten in die Regale. Wie ich mich umdrehe, steht auf einmal der Chinese da neben dem Schaukasten. Er verlangte ein Glas Wasser. ‚Ich brenne‚, sagte er. Ehe er noch das Glas, das ich ihm reichte, an die Lippen setzen konnte, brach er plötzlich zusammen …“
Eine Riesengestalt verdunkelte die Tür, ein uniformierter Polizist, den Gummiknüppel aktionsbereit in der Faust. „Was ist hier los?“ knurrte er.
Cavanaugh legitimierte sich und setzte ihm kurz auseinander, was vorgegangen war. „Sieht aus, als wäre der Mann vergiftet worden. Vielleicht hat man ihm das Gift in dem chinesischen Restaurant hier im oberen Stock beigebracht. Hör mal, Cashman“, fuhr er fort, sich an seinen Kollegen wendend, „pflanze dich auf der Treppe auf, die zum Restaurant hinauf führt, und laß keine Menschenseele heraus.“
Cashman gehorchte. Cavanaugh wandte sich jetzt an die Neugierigen, die sich mit offenem Mund draußen am Ladeneingang drängten.
„Hat einer von euch gesehen, wie der Fremde hier den Laden betrat?“ Er wies auf den Toten.
Ein paar schüttelten verneinend die Köpfe, dieser und jener stieß ein Grunzen aus, das ein Nein bedeuten konnte. Das war alles.
„Mit denen ist nichts merh zu wollen“, meinte er. „Die sind nur noch halb bei Bewußtsein, und ihr Hirnkasten ist so zusammengeschrumpft, daß nichts mehr drin Platz findet.“
Er machte sich daran, die taschen des Toten zu untersuchen, hütete sich aber sorgfältig, dabei die Lage des Körpers irgendwie zu verändern. Ein Eindollarschein, ein Zweidollarschein, eine Nickeluhr, zwei Würfel, ein kleines in rotes Leder gebundenes Notizbuch und ein Empfehlungsschreiben wurden zutage gefördert und einstweilen auf dem Ladentisch deponiert. Der Empfehlungsbrief rührte von einem gewissen Louis Strangaard her, der im vornehmen Westen New Yorks, in der 94. Straße wohnte.
Der Rettungswagen war noch immer nicht eingetroffen.In Gedanken versunken griff Cavanaugh nach den Würfeln und ließ sie über den Ladentisch rollen. Überrascht blickte er auf, und sah, wie der uniformierte Polizist vielsagend und ironisch grinste. Cavanaugh nickte ihm zu.
„Sie haben recht! Mit den Würfeln stimmt etwas nicht. Die sind gedoktort! Anscheinend haben wir es mit einem Falschspieler zu tun …“ Er wurde durch die Ankunft des Rettungswagens unterbrochen. Der begleitende Arzt betrat den Laden, warf rasch seinen schweren Mantel ab und machte sich an die Untersuchung des Toten.
„Was hat ihn wohl um die Ecke gebracht? Vergifteter Alkohol?“ erkundigte sich Cavanaugh.
„Kein Gedanke!“ antwortete kurz angebunden der Arzt. „An Gift ist der wohl schwerlich gestorben. Ein Herzschlag wäre denkbar …“
„So? Giftiger Alkohol ist es nicht, dann …“
Cavanaughs Augen huschten zu den so unschuldig aussehenden Würfeln auf dem Ladentisch hinüber, „dann gedulden Sie sich bitte einen Augenblick. Mir ist was eingefallen.“
Zum zweitenmal ließ er sich neben dem Toten auf die knie nieder. Der Arzt sah ihm mit einem etwas säuerlichen Lächeln zu. Es kam doch wirklich im Moment nicht auf eine genaue Diagnose an. Die Todesursache ließ sich nachher bei der Obduktion in aller Ruhe feststellen.
„Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, daß der Mann an einem Pistolenschuß gestorben sein könnte?“ meinte Cavanaugh aufblickend und den Arzt, der reichlich hochmütig dreinschaute, angrinsend.
„Nein!“ antwortete der Doktor. „Die Kugel müßte ja ein Loch zurückgelassen haben. Und Blut ist auch nirgends zu entdecken.“
Cavanaugh nickte. „Haben Sie doch die Güte, hier mal mit dem Finger herzufühlen … So! Dieser Mann ist ermordet worden, und zwar durch einen Nabelschuß. Das ist eine Spezialität in Chinatown. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie jetzt auch bemerken, daß der Anzugstoff etwas versengt ist. Die ‚Beilmänner‚ arbeiten heutzutage nicht mehr mit der Axt, höchstens benutzen sie hie und da noch ein gut geschliffenes Messer. Aber die verbreitetste Methode ist jetzt, dem Opfer einen Revolver auf das Mittelknöpfchen zu setzen – ein Druck – und die Sache ist passiert!“
Während sich der Kriminalbeamte noch des weiteren über die Erscheinungen des unterirdischen Krieges äußerte, der in den Chinesenvierteln der amerikanischen Städte fast dauernd zwischen den ‚Beilmännern‚, d. h. den bezahlten Banditen der verschiedenen Geheimverbindungen tobt, hatte sich der Arzt an eine neue Untersuchung der Leiche gemacht. Nachdem er zunächst den Anzug genau geprüft hatte, knöpfte er die Weste auf. Ein Hemd aus schwerster weißer Seide kam zum Vorschein. Der Doktor streifte es in die Höhe. Jetzt zeigte sich da, wo der erfahrene Polizist vermutet hatte, tief eingebettet in der Bauchmuskulatur, eine kaum wahrnehmbare, von einem bläulichen Ring umgebene Wunde.
Mit verblüfftem Gesicht starrte der Arzt die beiden Polizisten an.
„Darauf war ich natürlich nicht gefaßt. Man sollte meinen, bei einer Schußwunde müßte wenigstens ein Tropfen Blut zum Vorschein kommen. Jetzt verstehe ich erst. Er hat sich innerlich verblutet. Dem wäre nicht mehr zu helfen gewesen, auch wenn ich ihn noch lebend angetroffen hätte.“
Nachdenklich füllte er das vorgeschriebene Formular aus, schloß seinen Mantel und verließ den Laden. Als er den für ihn bestimmten kleinen Klappsitz in der Ambulanz einnahm, war der erstaunte Ausdruck noch immer nicht von seinen Zügen gewichen.
Sobald Cashmans telephonische Meldung bei der Polizeizentrale eingelaufen war, setzte sich auch schon der feindurchorganisierte Mechanismus des Morddezernats automatisch in Bewegung. Der aufnehmende Beamte gab die Nachricht sofort an die Staatsanwaltschaft, an den Polizeiphotographen und die übrigen beteiligten Dienststellen weiter.
Papiere, die über die Persönlichkeit des Toten Auskunft geben konnten, hatte man nicht gefunden. Dagegen ließ die Anwesenheit der ‚gedoktorten‚ Würfel die Vermutung nicht unberechtigt erscheinen, daß der Unbekannte mit den Gesetzen schon einmal in Konflikt geraten sei. Deshalb rief Cavanaugh den Erkennungsdienst an und bat, ihm einen Fingerabdruck-Spezialisten zu schicken. Dem Empfehlungsbrief nachzugehen, behielt er sich für später vor. Es war ja nicht gesagt, daß das Schreiben auf den Toten überhaupt Bezug hatte.
Die Überwachung des Zigarrenladens vertraute er dem uniformierten Polizisten an. Er selbst wandte sich seinem Kollegen zu, der noch immer auf der Treppe zum Restaurant Posten stand.
„Wir wollen hinauf und Matuichi Sakai ins Gebet nehmen“, meinte er. „Der Tote ist zwar ein Japaner, aber ich will meinen Hut fressen, wenn er nicht wenige Minuten, bevor er den Geist aufgab, noch in Sakais Restaurant gegessen hat.“
Ein Glaskasten, in dem Zigarren und Zigaretten ausgestellt waren, eine Registrierkasse und ein hoher dreibeiniger Bürostuhl waren das einzige, was in dem großen, saalartigen Restaurant an westliche Zivilisation erinnerte. Alles andere war so orientalisch wie möglich.
Als Cavanaugh mit einem Ruck die Tür aufriß und das restaurant betrat, erschien der Besitzer selbst, um seine Besucher zu begrüßen.
„Merkwürdig still ist es heute bei Ihnen, Sakai“, bemerkte der Beamte trocken.
Der Chinese nickte mit dem Kopf und antwortete in einem seltsamen Singsang: „Noch sehr früh am Abend sein.“
Caanaugh warf einen Blick über die Tische. Nirgends war ein Zeichen zu bemerken, daß ein Gast eben erst das Restaurant verlassen hatte. „Ich möchte einmal in Ihre Küche sehen, Sakai.“
„Sie blicken-sehen wollen jemanden in Küche?“ erkundigte sich der Restaurantbesitzer in den liebenswürdigsten Tönen. „Niemand drin als mich und Küchenjungen.“
Der Beamte gab keine Antwort, bis sie in der Küche standen, die sich durch makellose Sauberkeit auszeichnete. Auf dem riesigen schwarzen Herd brodelte es in unzähligen Töpfen.“Sakai!“ Cavanaugh fuhr unvermutet auf dem absatz herum und starrte den Chinesen an. „In Ihrem Restaurant ist vor knapp fünfzehn Minuten ein Japaner angeschossen worden. Was wissen Sie darüber?“
„Hierher kommen nur Chinesen“, protestierte Sakai. „Keine Japanesen, keine Amelikaner.“
Je länger das Verhör dauerte, eine desto größere Unkenntnis der englischen Sprache entwickelte sich bei Sakai. Zuletzt schien er überhaupt kein Wort zu vertehen. Cavanaugh riß endlich die Geduld. Entrüstet erklärte er: „Jetzt werden Sie gefälligst mitkommen und ‚blicken-sehen‚, ob Sie den Kerl kennen!“
„Und Lestaulant?“ fragte der Chinese. „Ich kann ihm nicht verlassen.“
Ohne sich um diesen Einwand zu kümmern, schritt Cavanaugh zur Tür und winkte einen Kollegen heran, der draußengebleiben war. „Ich nehme jetzt Sakai mit hinunter“, erklärte er. „Solange ich im Laden bin, kann der uniformierte Polizist den Restauranteingang bewachen. Du könntest inzwischen die Wände und den Boden abklopfen, ob sich irgendwo eine hohle Stelle findet. Vielleicht ist ein Versteck irgendwo hinter der Täfelung angebracht. Ich habe den Überrock und den Hut des Toten hier nirgends sehen können. Auch von einem Revolver ist nichts zu entdecken. Aber der da“, er deutete mit dem Zeigefinger aus Sakai, „weiß eine ganze Menge mehr, als er zuzugeben gewillt ist.“
„Aber Mista, Mista!“
Zum erstenmal legte der Chinese eine gewisse Aufregung an den Tag.
„Das nicht gehen. Sie nicht ihn lassen können im Lestaulant. Er nicht kann Essen … Essen machen.“
„Ach, das wird sich schon finden, Sakai“, erklärte Cavanaugh grob. „Jetzt marsch!“
Sakai ließ sich mit hinunterschleppen, warf einen jeden Interesses baren Blick auf die Leiche und bestritt energisch, etwas über den Mann zu wissen.
Und dabei blieb es! Vergeblich verhörte man die Nachbarn. Niemand hatte den Unbekannten das Restaurant betreten sehen. Angeblich war niemand in der Nähe gewesen, als er den Zigarrenladen aufsuchte, in dem er starb. Niemand hatte einen Schuß gehört. Niemand war in der Lage, den Toten zu identifizieren.
Die beiden Beamten sahen keine andere Möglichkeit, als nach dem Westen hinaus zu fahren und den Mann zu verhören, von dem der bei dem Toten gefundene Empfehlungsbrief herrührte. Ein Polizeiauto schaffte inzwischen Sakai und eine Kollektion anderer Chinesen zum Distriktsstaatsanwalt.
Nachts um zwölf kamen Cavanaugh und sein Kollege zurück. Die Verhöre waren noch im Gang. Der Erkennungsdient hatte inzwischen die Persönlichkeit des Toten ermitteln können. Er hieß Ishi-Maru Hiroshi alias Kiski Keroshi. Zweimal schon hatten sich die Behörden mit ihm beschäftigen müssen. Am 13. März 1919 hatte man ihn festgenommen, weil er im Verdacht stand, einem anderen Japaner in der Mott Street einen Dolchstoß beigebracht zu haben. Die zweite Verhaftung erfolgte am 9. Januar 1921 wegen unerlaubten Waffenbesitzes.
Der Restaurateur behauptete nach wie vor, Hiroshi nicht zu kennen, auch nie von ihm gehört zu haben. Obwohl man ihn dreieinhalb Stunden ins Kreuzverhör nahm, blieb er mit ebenso großer Zähigkeit wie Höflichkeit bei seiner ersten Aussage.
In dem roten Notizbuch des Toten hatte sich eine ganze Anzahl Adressen von Japanern und Chinesen gefunden. Ein großes Aufgebot von Beamten war fieberhaft tätig, die Betreffenden aufzuspüren und zu verhören. Nur die besten Kräfte der Kriminalpolizei kamen dafür in Betracht, denn einen Asiaten zum Reden zu bringen, wenn er nicht will, ist ein ebenso großes Kunststück, wie eine Auster mit dem bloßen Fingernägeln zu öffnen.
Cavanaugh und Cashman gesellten sich zu ihren Kollegen, die bereits in einem der Diensträume warteten. Gleich darauf betrat der Inspektor das Zimmer, um ihren Rapport entgegenzunehmen. Er wandte sich zuerst an Cavanaugh.“Nun, was hat Herr Strangaard über den Mann mitgeteilt?“
„Er hat ihm das beste Zeugnis ausgestellt“, lautete die Antwort. „Im übrigen hat er es aber als ganz überflüssig bezeichnet, daß er eigens nach der City kommt, um seinen früheren Diener zu identifizieren.“
„Wie steht es mit Ihnen, Donahue?“ fragte der Chef, sich and einen anderen beamtenw endend.
„Haben Sie in Mills Hotel Glück gehabt?“
„Ich habe festgestellt, daß der in dem Notizbuch genannte Kingo Jumura tatsächlich dort wohnt“, erwiderte der Detektiv. „Ich habe ihn gesprochen. Er gab zu, Hiroshi schon seit einigen Jahren zu kennen. Die Bekanntschaft sei aber sehr flüchtig gewesen. Er habe Hiroshi immer für einen Falschspieler gehalten. Die Opfer, die er plünderte, suchte er sich immer unter den Mitgliedern der japanischen Kolonie. Wenn es beim Spiel um hohe Summen ging, gab es regelmäßig nachher Krach. In Philadelphia und verschiedenen anderen Großstädten hat man schließlich dafür gesorgt, daß ihm der Aufenthalt unmöglich gemacht wurde. Unter den Japanern der besseren Stände galt er als ein Paria. Man wollte nichts mit ihm zu tun haben. Auffällig ist, daß er immer gut bei Kasse war. Ob Hiroshi irgendeiner Unterweltorganisation angehört, ist Jumura nicht bekannt. Jedenfalls sind ihm überall sowohl Japaner wie Chinesen möglichst aus dem Weg gegangen, weil er in dem Rufe stand, mit dem Messer sehr rasch bei der Hand zu sein.“
„Es hat ja ganz den Anschein“, meinte der Inspektor zum Schluß der Besprechung, „daß der Mann, der hinter dieser Bluttat steckt, auch sonst noch einiges auf dem Kerbholz hat. Ich bin überzeugt, unser Freund Sakai hat nicht alles ausgesagt, was er weiß. Äußerlich ist er zwar die Gelassenheit selbst, aber so gut er es auch zu verstecken versucht, man merkt es ihm an, wie nervös er ist. Cavanaugh, Sie werden so freundlich sein, mit Cashman zusammen noch einmal das Restaurant aufzusuchen und den Boden und die Wände abzuklopfen. Es darf kein Zoll breit ununtersucht bleiben. Sollte sich Sakai inzwischen zum Reden entschließen, telephoniere ich. Später bin ich vielleicht auch in der Lage, Ihnen noch einige Beamte zur Untersuchung zu senden.“
Als die beiden Kriminalwachtmeister die Polizeizentrale verließen, ging es bereits auf vier Uhr morgends. Die ersten Straßenhändler waren mit ihren Karren zur Zentralmarkthalle unterwegs, wo sich in diesen Morgenstunden gewöhnlich ein wilder Kampf um die besten Gelegenheitskäufe abspielte.
Auf eine Straßenbahn zu warten, schien hoffnungslos. Da war es noch besser, den Weg nach Chinatown zu Fuß zurückzulegen.
„Es wäre dringend zu wünschen, daß der sonst allgegenwärtige Herr Fu von sich hören läßt“, meinete Cashman, während er neben seinem Kollegen durch die öden Straßen marschierte.
„Da mach`dir mal keine Hoffnungen“, erwiderte Cavanaugh. „Herr Fu ist immer erst dann zu sprechen, wenn wir einen Verdächtigen beim Kragen genommen haben … Das ist auch so eine komische Type. Ein ungewöhnlicher Mensch ist er sicherlich.“
„Der könnte die Hauptfigur in einem Roman abgeben“, lachte Cashman. „Mit seiner feinen Aufmachung, seiner Intelligenz und seiner Doppelrolle, die ihn sowohl mit der Polizei, wie mit der Unterwelt heimlich in Verbindung bringt, wäre er sehr gut zu einem Romanhelden geeignet. Man liest doch solche Sachen. ‚Der Mann mit der geheimen Mission‚ und ähnliches Zeug.“
„Du vergißt bloß“, knurrte Cavanaugh, „daß mit einem Spitzel wie Fu auch in einem Roman kein Staat zu machen ist. Und unser Herr Fu ist nichts weiter als ein gemeiner Spitzel. Es sollte mich wirklich nicht wundern, wenn es sich eines Tages herausstellt, daß er es mit beiden Seiten hält. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Es ist ein Leben auf dem Pulverfaß, und eines Tages wird er wohl auch hochgehen. Das weiß er übrigens selbst auch. Deshalb verabredet er sich mit uns auch immer an einer anderen Stelle und hegt eine Abneidung gegen solche Treffpunkte wie Zigarrenläden und so weiter.“
„Ich wundere mich nur, daß er keine Angst hat, wenn ihn der Chef oder der Staatsanwalt zu sich aufs Büro rufen läßt. Es könnte ihm ja einmal passieren, daß er ein Wort zu viel redet und sich etwas entschlüpfen läßt, das vor Gericht als Beweismaterial gebraucht werden kann. Wenn er öffentlich als Zeuge im Gerichtssaal erscheinen muß, ist es mit seinem Gewerbe als Spitzel aus.“
Da sei keine Gefahr, meinte Cavanaugh. Herr Fu sei viel zu gerissen, um sich derart fangen zu lassen. Seine informationen waren nie so beschaffen, daß sie ohne weiteres als Beweismittel benutzt werden konnten.Er begnügt sich damit, der Kriminalpolizei gegen bares Geld gewisse Hinweise zu geben, wo ein Verdächtiger zu finden war, ob er zu fleihen plane und welchen Weg er einschlagen werde. Den rest überließ Herr Fu den Beaten. „Die Polizei“, so schloß Cavanaugh sein referat über Herrn Fu, „hat alles Interesse daran, die Finger von ihm zu lassen. Ihn festzunehmen wäre ebenso töricht, wie die henne zu schlachten, die die goldenen Eier legt. So bestimmt auf der Nacht der Morgen folgt, so bestimmt wird Herr Fu anklingeln, sobald er wittert, daß wir in dieser Mordaffäre ungefähr auf der richtigen Spur sind.“
Die beiden Beamten waren an ihrem Ziel angelangt. Die Haussuchung, mit der sie beauftragt waren, erwies sich als eine lange un dmühsame Arbeit. Der Chinese ist geradezu ein Künstler in der Anlage von Verstecken. Es ist eine bekannte Tatsache, daß in den Chinesenvierteln der amerikanischen Großstädte geheime Gänge von Haus zu Haus führen, in denen man manchmal straßenweit unter der Erde wandern kann. Die Polizei tut ihr Möglichstes, um diese Schlupflöcher zu verstopfen, aber immer wieder werden neue angelegt, ehe sie noch den Rücken gewandt hat.
Die Wände des Restaurants waren mit einer reichgeschnitzten Holztäfelung bedeckt. Überall hinter dieser Verschalung konnte sich ein Versteck befinden. Jeder hervorspringende Teil der Schnitzerei, jede geschnitzte Blütenknospe konnte den Druckknopf darstellen, der die geheime Feder des verstecks öffnete und schloß.
Um acht Uhr morgens hatte sich, trotz eifrigen Suchens, noch immer nichts gefunden. Zur Verstärkung erschienen zwei Beamte von der Polizeizentrale. Sie brachten große Neuigkeiten mit. Man hatte einen Chinesen aufgetrieben, der den ermordeten Hiroshi einige Tage früher als Gast in Sakais Restaurant gesehen hatte.
Auf dieses Zeugnis hin bequemte sich Sakai, der bisher immer behauptete, Hiroshi habe niemals die Schwelle seines Restaurants überschritten, einzuräumen, daß seine Angaben nicht der Wahrheit entsprachen. Mit umso größerer Hartnäckigkeit hielt er aber daran fest, daß Hiroshi am Tage seines gewaltsamen Todes nicht im Restaurant gewesen sei. Im übrigen beklagte er sich über den Schaden, den Hiroshis Besuche ihm verursachten, denn die Gäste weigerten sich, mit diesem im selben Lokal zu essen, mit der Begründung, er sei ein gewalttätiger Mensch, dem man nicht trauen könne. Von Hiroshi hieß es, daß er Mitglied einer großen, unterirdischen Organisation wäre. Man konnte ihn also nicht einfach an die Luft setzen, und Sakai kam dadurch gewaltig in die Klemme. In seiner Kasse machten sich Hiroshis Besuche bedenklich geltend. Jedesmal nach einem solchen Besuch waren die Einnahmen gesunken.
Cavanaugh, der interessiert zugehört hatte, meinte: „Das ist ja alles ganz schön, aber esw ird Sakai wenig helfen. Im Gegenteil. Um so eher besteht die Möglichkeit, daß er Hiroshi selbst aus dem Weg geräumt hat.“
Sakai erfreute sich in ganz Chinatown eines glänzenden Rufes. Nicht nur wegen seiner Wohlhabenheit gehörte er zu den angesehensten Mitgliedern der chinesischen Kolonie. Trotzdem war es natürlich nicht ausgeschlossen, daß Hiroshi durch allerlei Erpressungen oder durch die Hartnäckigkeit, mit der er Sakais Gästen seine ungebetene Gesellschaft aufdrängte, den Restaurationsbesitzer zum äußersten getrieben hatte.
Je weiter der Tag fortschritt, desto trüber sah es für Sakai aus. Die Obduktion ergab, daß Hiroshi wenige Minuten vor seinem Tode ein Gericht Nudeln zu sich genommen hatte. Wo anders als in Sakais Restaurant? Un dnur dort konnte er auch die tögliche Verletzung davongetragen haben, denn die Ärzte erklärten ausdrücklich, es sei für ihn unmöglich gewesen, mit einem Bauchschuß dieser Art noch eine längere Strecke zurückzulegen.
Allmählich war es Mittag geworden. Cashman und die anderen Beamten klopften und hämmerten noch immer an den Wänden, auf der Suche nach einer hohlen Stelle. Ein unterdrückter Ausruf des Erstaunens ließ sie hochfahren. Sie sahen sich nach Cavanaugh um. Er war nirgends zu sehen.
Sie liefen in die Ecke, wo er zuletzt gewesen war, dort lag Cavanaughs riesige Gestalt ihrer ganzen Länge nach auf dem Boden.
„Komm her, Cashman!“ rief er mit allen Anzeichen der Erregung. „Ich glaube, wir haben gefunden, was wir so lange gesucht haben. Horch mal!“
Sein Freund und Kollege kniete neben ihm nieder und streckte lauschend den Kopf vor.
„Klingt das nicht, als wäre hier unter dem Fußboden eine hohle Stelle? Die Dielen sehen zwar aus, als hätte sie seit Jahrzehnten kein Mensch angerührt, aber diese chinesischen Spitzbuben sind schlau. Im Tarnen können sie geradezu Wunder tun.“
Cashman und die anderen Beamten spitzten die Ohren, als er die Bodenbretter abklopfte.
„Es stimmt!“ meinten sie. „Es klingt wirklich hohl.“
Sie beschlossen jedoch, einstweilen nichts weiter zu unternehmen, ehe der Polizeichef und die Staatsanwaltschaft benachrichtigt waren. Auf die telephonische Meldung kam der Befehl zurück: „Nichts anrühren! Wartet, bis wir Sakai hinüberbringen. Merken Sie sich nur die Stelle, wo der Boden hohl klingt. Sakai wird sofort in ein Auto gesetzt und hingeschafft. In zehn Minuten sind wir da.“
Die Miene des Chinesen gilt als die undurchdringlichste und unbeweglichste der Welt. Aber was Sakai empfand, spiegelte sich deutlich in seiner Haltung. Gebeugten Rückens und mit hängenden Schultern kam er in den großen Speisesaal geschlürft. Zwei Kriminalbeamte und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft begleiteten ihn.
„Die Beamten haben auf Ihre Ankunft gewartet“, erklärte ihm der Vertreter der Staatsanwaltschaft. „Wir wollen nicht die Bodenbretter aufreißen, ehe sie zugegen sind. Haben Sie uns vielleicht etwas mitzuteilen, bevor wir an die Arbeit gehen? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, an das Versteck unter dem Fußboden zu gelangen?“
Sakai nickte zwei oder dreimal stumm mit dem Kopf, ehe er den Gebrauch seiner Stimme wiederfand. Dann überstürzten sich die Worte in einem kaum verständlichen Kauderwelsch. Seine dünne, zitternde Stimme schien mehr zu einem Greis von sechzig Jahren zu passen, als zu einem Mann, der kaum die Dreißig überschritten hatte. „Armer Sakai“, seufzte er. „Sie gefunden haben, wo es steckt, großer Kistenkasten. Siebzehntausend Dollar und zwei Pistolen – und Rock und Hut. Geld, mein Geld – auch Pistolen – aber Hut und Rock Hiroshis Hut und Rock – er kommen zu mir mit Troachi Soejima – Hiroshi übler Strolch- Soejima ganz böser japanischer Halunke – ein wahrer Teufel. Soejima – sie Würfel spielen, – sie sich zanken – sie losgehen – sie schießen.Soejima böse – wenn ich ausplaudere – er herkommen mit Männern, die mich totschießen – bitte, Mista, kommen in Küche. Ich euch zeigen, wie finden Kistenkasten.“
„Wie heißen die Leute, die zu Hiroshis Bande gehörten?“ fragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft.
„Ich gelogen habe“, antwortete Sakai gelassen. „Ich nichts weiß von Hiroshis Bande. Er Totschläger sein, aber er arbeiten auf eigene Faust. Aber Soejima hat Bande. Er grausamer Halunke. Wenn er mich erwischen …“
„Na, darüber brauchen Sie sich einstweilen keine Sorgen zu machen“, meinte der Distrikststaatsanwalt kühl. „Sie werden wohl manche Woche von uns gut unter Verschluß gehalten werden, daß keiner an Sie heran kann. Wir sind von Ihnen derart angelogen worden, daß man wirklich nicht mehr weiß, ob und wann Sie einmal die Wahrheit sagen.“
Sakai zeigte den Kriminalbeamten, wie man von der Küche aus an den hohlen Raum gelangen konnte. Wie er gesagt hatte, fanden sie siebzehntausend Dollar in schmierigen und beschmutzten Banknoten, zwei Pistolen und Hiroshis Hut und Mantel. Alles war zusammen in einen schwarzen, eisenbeschlageneen Koffer verpackt. Die Waffe, aus der der verhängnisvolle Schuß abgefeuert worden war, ließ sich jedoch nirgends entdecken.
Auch dieser Fund war nicht gerade geeignet, Sakai zu entlasten. Der Restaurantbesitzer war der einzige Zeuge des Mordes, er hatte die Beamten wiederholt in sträflicher Weise belogen, und er hatte einen triftigen Grund, Hiroshi unter die Erde zu wünschen. Hätte Troachi Soejima Verstand genung besessen, zu bleiben wo er war, und sich nicht durch sein Benehmen auffällig zu machen, so wäre die Sache voraussichtlich an Sakai hängen geblieben. Aber Soejima war dazu eben nicht klug genug. Er war geflohen und schien unauffindbar. Es war, als hätte ihn die Erde verschlungen.