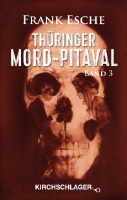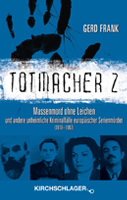Mit furchtbarer Grausamkeit verübt ein „Nachtgespenst“ die unheimlichsten Verbrechen, welche die Bevölkerung mit solchem Abscheu erfüllen, daß sie nur mit den größten Anstrengungen und Opfern an Menschenleben von einer Lynchjustiz abgehalten werden kann.
In der Nacht vom 28. zum 29. Juni 1926 schlich ein schäbig gekleidetes Individuum die Nebraska Avenue in Tampa1 entlang. Der Mann machte hier und da halt, strich ein Zündholz an und versuchte bei dessen dürftigem Licht eine der Hausnummern zu entziffern. Das ganze Viertel, das zu den ärmeren der Stadt gehörte, lag verlassen da. Nur selten tauchte ein vereinzelter Passant auf, der nach Hause eilte, ohne sich um das Treiben des Schäbigen zu kümmern. Auch von einem Polizisten war nichts zu erblicken – und doch wären vielleicht fünfzehn Menschen noch am Leben, wenn in diesem Augenblick ein Beamter aufgetaucht wäre, und sich des verdächtigen Individuums angenommen hätte. Die schleichende Gestalt war an einem einstöckigen Fachwerkhäuschen angelangt. Wieder flackerte ein Streichholz auf. Die Hausnummer war 116.
Leise stahl er sich an eines der Fenster und versuchte es zu öffnen. Es war nicht verriegelt. Rasch und geräuschlos drückte er es auf und stieg ins Haus.
Die vier Hausbewohner lagen in tiefem Schlaf. Bec D. Rowell, der Haushaltsvorstand, schlief in einem Zimmer für sich, in einem anstoßenden Raum Rowells Mutter, die nicht mehr weit von ihrem 70. Geburtstag entfernt war, und ihre Nichte Eva, die eben erst die Kinderschuhe ausgetreten hatte. Das Zimmer an der Straße bewohnte ein Mann in mittleren Jahren, Charles Alexander, als Untermieter.
Als der Eindringling in dieses Vorderzimmer gelangt war, fuhr er unter den Mantel und brachte eine Axt mit gekrümmtem stiel zum Vorschein. Mit dieser Waffe in der Hand trat er an das Bett des Schlafenden. Eine rauhe Hand packte die Schulter des Untermieters Alexander und rüttelte ihn wach. Er zuckte zusammen und riß die Augen auf.
„Was ist los?“ fragte er. Er wußte nicht recht, wer an seinem Bett stand.
„Ist Frau Rowell zu Hause?“
Jetzt erst wurde der Untermieter hellwach. Er schnellte im Bett in die Höhe.
„Hören Sie nicht?“ fragte der Eindringling erneut. „Ist Frau Rowell zu Hause?“
„Welche Frau Rowell meinen Sie denn?“ fragte Alexander, um Zeit zu gewinnen.
„Die Frau von Frank Rowell.“
„Was? Nee, die wohnt ja nicht mehr hier.“
Das waren Alexanders letzte Worte, denn gleich darauf sauste die Axt herab und spaltete ihm den Schädel. Aber der Mörder hatte sein blutiges Werk damit erst begonnen.
Wie ein trunkener Dämon betrat er das Zimmer, wo das junge Mädchen und die Greisin in tiefem Schlaf lagen. Wieder hob sich die Axt. Zum zweitenmal löschte sie mit einem dumpfen, entsetzlichen Krachen ein Menschenleben aus. Die alte Frau war immer noch nicht wach geworden. Sie sollte die Augen nicht mehr öffnen. Denn auch sie fiel der Axt des nächtlichen Würgers zum Opfer.
Und noch immer schien es ihm nicht genug. Es war, als sei er von dem wilden Wunsch besessen, in den Annalen der Kriminalgeschichte eine Spur zu hinterlassen, die nicht so leicht wieder auszulöschen war.
Jetzt betrat er das Zimmer, in dem Rowell den Schlaf eines Menschen schlief, der sich Tag für Tag an der Werkbank um den Lebensunterhalt für sich und die Seinen abrackert. Der Mörder behandelte sein ahnungsloses Opfer, wie eine Katze ihre Beute, ehe sie zum entscheidenden Sprung ansetzt. Plötzlich hob sich die Axt, die noch vom Blut der vorangegangenen Opfer triefte. Wie ein Blitz sauste die Axt herab auf das Haupt des schlafenden Arbeiters.
Am folgenden Morgen klopfte eine Nachbarin, die häufig bei der alten Frau Rowell vorsprach, an die verschlossene Tür. Niemand gab Antwort. Dies schien seltsam. Gewöhnlich war die Greisin schon früh am Morgen auf den Beinen. Ein unheimliches Vorgefühl bemächtigte sich der Besucherin, als sie jetzt feststellte, daß überall die Vorhänge noch heruntergelassen waren. Das war ganz ungewöhnlich. Eine tiefe beklemmende Stille herrschte.
Ein Polizist wurde gerufen. Er stieg durch dasselbe Fenster ein, das dem Mörder als Eingang gedient hatte, und entdeckte zu seinem Entsetzen, daß die Wohnung dem Inneren eines Schlachthauses glich. Binnen einer stunde wußte die ganze Stadt von dem furchtbaren ereignis. Niemals war bislang ein derartig abscheuliches Verbrechen in Tampa zu verzeichnen gewesen. Mit überraschender Schnelligkeit verbreitete sich die Nachricht auch in die Umgebung. Zu Fuß und im Auto strömten Hunderte von erregten Menschen in die Stadt.
Die Kriminalbeamten, die am Tatort erschienen, waren an manchen blutigen Anblick gewöhnt. Trotzdem gab es einige unter ihnen, die erbleichten, und kaum in der Lage waren, ihren Pflichten nachzukommen. Eine kurze ärztliche Untersuchung ergab mit hinreichender Sicherheit, daß alle Opfer im Schlaf überfallen worden waren und von dem ihnen drohenden Schicksal nichts geahnt hatten.
Trotz gründlichster Nachforschungen war im Hause nichts zu entdecken, das einen Hinweis auf den Urheber des Verbrechens gegeben hätte. Auch der Hof und alle übrigen Teile des kleinen Grundstücks wiesen keine Fingerzeige auf. Die Hinterlassenschaft der vier Toten wurde mit peinlichster Sorgfalt gemustert, um zu ermitteln, ob ein Mitlied der Familie Rowell oder vielleicht der Untermieter in irgendwelche Angelegenheiten verwickelt war, die als Motiv der Morde gelten konnten. Es fand sich jedoch nicht das geringste. Je mehr die Zeit fortschritt, desto undurchdringlicher schien das Dunkel zu werden, das die entsetzliche Tat bedeckte.
Die Bewohner der umliegenden Häuser wurden vernommen, um festzustellen, ob sich jemand am vorangegangenen Abend in verdächtiger Weise in der Nähe des Rowellschen Häuschens herumgetrieben habe. Auch hier war man rasch auf einen toten Punkt angelangt. Der Mörder hatte die Szene des Verbrechens erst betreten, als ringsum alles in tiefstem Schlummer lag.
Keiner der in solchen Fällen üblichen Maßnahmen wurde versäumt. Nachforschungen auf den Bahnhöfen, polizeiliche Besuche in den billigen Logierhäusern, alles blieb ergebnislos. Nach 24 Stunden war die Polizei noch immer dort, wo sie begonnen hatte. Vier Menschen waren ermordet – und man hatte keine Ahnung, wer der Täter sein könne, ja, man wußte nicht einmal, auf welche Beweggründe die grauenvolle Bluttat zurückzuführen war.
Obwohl sich die polizeilichen Nachforschungen auf die ganze Stadt erstreckten, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit vor alem auf das Quartier Latin von Tampa, auf Ybor City. Dieses malerische Stadtviertel mit seinen eigenartigen Läden und Kneipen ist von einem bunten Völkergemisch bewohnt, unter dem Spanier, Italiener und Kubaner die Hauptrolle spielen. In ganz Amerika gibt es nichts so Bizarres wie Ybor City und das Viertel gilt als einer der interessantesten Winkel von Florida.
Obwohl das Viertel äußerlich einen ganz respektablen Eindruck macht, ist ihm doch ein beträchtlicher Prozentsatz an gestrandeten Existenzen nicht erspart geblieben, und deshalb stiegen die Kriminalbeamten auch in die verstecktesten Winkel dieser in sich abgeschlossenen bizarren Welt hinab, um sich nach dem Massenmörder umzusehen. Bald schien der, bald schien jener verdächtig und wurde heimlich überwacht. Manchmal wurde jemand tagelang Schritt für Schritt verfolgt, bis dann die Beamten enttäuscht feststellen mußten, daß der Betreffende in der Lage war, seine Unschuld unanfechtbar nachzuweisen.
Die Tage wurden zu Wochen. Die Wochen zu Monaten. Und immer noch war der Mörder nicht gefaßt. In der Öffentlichkeit wurde die Tätigkeit der Polizei aufs schärfste kritisiert. Nach und nach aber wandte sich doe öffentliche Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Der vierfache Mord schien, wie so manches, der Vergessenheit anheimgefallen zu sein.
Wir kommen nun zu Ereignissen, die sich im Jahre darauf in der Nacht vom 26. bis 27. Mai abspielten. In ziemlicher Entfernung von dem ehemaligen Haus der Rowells – das übrigens im Laufe des Jahres abgebrochen worden war – lebte ein gewisser Merrill mit seiner Familie. Die Merrills hatten ihre jetzige Wohnung, eine Art Wochenendhäuschen, erst vor drei Monaten bezogen.
Es war zwischen elf und zwölf Uhr nachts. Ein schäbig angezogenes Individuum, das einen Schlapphut tief in die Stirn gezogen hatte, pilgerte mit unbeholfenen Schritten an den Straßenbahnschienen entlang, die sich durch die First Avenue ziehen. Als er an der Ecke der 31. Straße angelangt war, blieb er vor dem Häuschen der Merrills stehen, blickte sich verstohlen um und schlich sich dann an eines der Vorderfenster. Ein an den Fensterrahmen genageltes Drahtnetz zum Schutze gegen die Fliegen verwehrte ihm den Eingang. Nachdem er sich zunächst vergewissert hatte, daß die Bewohner des Hauses im tiefen Schlaf lagen, zog er ein großes Messer aus der Tasche und schnitt den größten Teil des Drahtnetzes aus dem Rahmen heraus. Gleich darauf glitt das Nachtgespenst geräuschlos durch die entstandene Öffnung.
Knapp eine halbe Stunde später kam der Mann mit dem Schlapphut wieder zum Vorschein, schlich die Straße entlang und verschand in der Dunkelheit. Wenige Schritte vom Haus schleuderte er einen schweren Hammer, den er bis dahin in der Hand getragen hatte, achtlos beiseite.
Im Haus der Merrill hatte der Tod seinen Einzug gehalten, Looney Merrill lag tot neben seiner Frau und seinem fünf Wochen alten Kind. Der Mörder hatte ihm den Schädel eingeschlagen. Neben ihm ächzte, zwischen Tod und Leben schwebend, seine Frau. Das Kind, das zwischen Vater und Mutter geschlafen hatte, war ebenfalls durch einen Hammerschlag gestreift worden. Es war verwundet, wenn sich auch die Verletzung als nicht lebensgefährlich erwies. Im anstoßenden Zimmer atmete niemand mehr. Merrills Tochetr Mildred, sein elfjähriger Sohn Ralph und der dreijährige Wallace lagen mit eingeschlageneen Schädeln tot in ihrem Blute.
Ein fünftes Kind, der achtjährige Hugh, war durch einen glücklichen Zufall den Hieben des Mörders entgangen. Einer seiner Brüder, mit dem er das Lager teilte, hatte sich zufällig im Schlaf herumgewälzt und ihn dabei aus dem Bett gestoßen. Das Bettgestell war sehr niedrig. Vermutlich ist es darauf zurückzuführen, daß der Junge seltsamerweise nicht aufwachte.
War die Erregung der Bevölkerung schon nach der Entdeckung des Mordes im Rewellschem Haus groß gewesen, so stieg sie aufs zehnfache, als die neue furchtbare Bluttat ans Licht kam.
Frau Merrill war noch etwa zwei Tage am Leben, ehe sie ihren entsetzlichen Verwundungen erlag. Mindestens ein Kriminalbeamter saß dauernd an ihrem Krankenlager, um für den Fall, daß sie noch einmal für einen Augenblick das Bewußtsein wiedergewinnen sollte, zur Stelle zu sein, und wenn möglich etwas über den Täter zu erfahren, das seine Verhaftung erleichtern konnte.
Wenige Minuten vor ihrem Tode flackerte die erloschene Lebenskraft der Frau noch einmal auf. Sie war gerade noch imstande zu flüstern: „Ein großer Mann hat mich niedergeschlagen!“ Dann starb sie.
Die Polizei ergriff dieselben Maßnahmen wie nach der abscheulichen Bluttat des Vorjahrs. Und wieder war es wie damals! Es schien nicht die geringste Spur des Täters vorhanden, ebenso wie jedes Motiv für die Tat fehlte.
Endlich schien man dem Geheimnis näher zu kommen. Bei der Polizei meldete sich die Frau eines Schaffners, der bei der durch die First Avenue führende Vorortbahn angestellt war. Sie hatte in der fraglichen Nacht an einer Ecke auf ihren Mann gewartet. Dabei war ihr ein schäbig gekleideter Mann mit einem Schlapphut aufgefallen, der sich in der Nähe des Merrillschen Hauses an den Schienen herumtrieb.
„Wären Sie in der Lage, den Mann zu identifizieren, wenn Sie ihn wieder zu Gesicht bekämen?“ fragten die Beamten.
„Aber gewiß!“
Osteen, ein Schaffner bei der bereits erwähnten Vorortbahn, der sogenannten Seaboard Line, meldete sich ebenfalls. Er hatte einige Stunden vor der Zeit, in der der Mord geschehen sein mußte, zwei verdächtige Gestalten sich in der Nähe der First Avenue und der 21. Straße herumdrücken sehen. Osteen, dem zu Ohren gekommen war, daß die Polizei einen Zuschlaghammer gefunden hatte, verlangte das Werkzeug zu sehen und stellte sofort fest, daß es sich um Eigentum der Seaboard Line handelte. Vermutlich war der Hammer aus einem kleinen Geräteschuppen gestohlen, der sich in der Nähe des Merrrillschen Hauses befand.
Mit verdoppeltem Eifer setzten die Behörden ihre Ermittlungen fort. Endlich hatte man etwas Greifbares, wo man einhaken konnte. Anscheinend war der Täter in Tampa ansässig. Der Beweis dafür war, daß er sich so gut auskannte. Binnen vierundzwanzig Stunden kam ein neuer merkwürdiger Umstand ans Licht. Kriminalbeamte, die in den dem Tatort benachbarten Häusern Umfrage hielten, erfuhren, daß das Haus, in dem Merrill ermordet worden war, noch vor drei Monaten von Frank Rowell – dem Bruder des vor einem Jahr ermordeten Bee Rowell – und seiner Frau, bewohnt wurde.
Es schien undenkbar, war aber jetzt doch in den Bereich der Möglichkeit gerückt, daß der Mörder Merrill und seine Familie infolge eines Irrtums hingeschlachtet hatte und daß es ihm eigentlich darum zu tun gewesen war, alle Mitglieder der Familie Rowell aus der Welt zu schaffen.
Noch einmal beschäftigten sich die Behörden eingehend mit der Vorgeschichte der Rowells. Weder Frank Rowell, noch seine Frau konnten sich auf irgendwelche Feinde ihrer Familie besinnen. Auch heute noch vermögen sie einen Grund für die Mordtaten nicht anzugeben.
In der Nähe des Merrillschen Hauses befand sich eine große Fabrik für Zigarrenkästen. Der Nachtwächter der Fabrik meldete sich jetzt mit der Mitteilung, daß er in der Mordnacht gegen elf Uhr einen Vagabunden von dem Fabrikgrundstück verwiesen habe. Man forderte ihn auf, eine Beschreibung des Betreffenden zu geben. Sie stimmte haargenau mit der Beschreibung überein, die die Frau des Bahnschaffners gegeben hatte, freilich waren in beiden Fällen die Angaben nicht sehr präzise, aber sowohl die Schaffnersfrau wie der Nachtwächter erklärten mit Bestimmtheit den Betreffenden wiedererkennen zu können, wenn er ihnen gegenübergestellt werde.
Nun erst trat die entscheidende Wendung ein. Einige Tage später klingelte das Telefon beim Polizeichef. Eine Unbekannte fragte: „Wer ist dort? Ist dort die Polizei?“
„Jawohl. Worum handelt es sich?“
„Hier spricht Frau Lizzell Banta. Ich bin Wahrsagerin. Wenn sie einen Kriminalbeamten zu mir schicken, kann ich Ihnen vielleicht wichtige Mitteilungen zu der Mordaffäre Merrill machen.“
Bei der Polizei war man skeptisch. Immerhin konnte man es sich nicht leisten, an der kleinsten Kleinigkeit vorbeizugehen, sowenig stichhaltig die Sache auch zunächst erscheinen mochte. So war denn in kurzer Zeit ein Kriminalbeamter im Auto zu Frau Banta unterwegs.
Die Dame, die ihn empfing, machte einen ausgesprochen intelligenten Eindruck. Der Beamte zeigte seine Dienstmarke vor, und Frau Banta kam sofort zum Thema. Sie berichtete, daß am Tage nach der Bluttat im Hause Merrills zwei Männer bei ihr vorgesprochen hätten, die ihr sehr verdächtig vorkamen. Die beiden erklärten, sie machten sich große Sorgen und möchten gerne wissen, ob die Wahrsagerin ihnen verraten könne, was die Zukunft für sie berge. Frau Banta versprach ihr Bestes zu tun und erkundigte sich, worüber die beiden sich denn Sorgen machten.
„Ach, es handelt sich um eine furchtbare Geschichte“, antwortete einer der beiden. „Wir möchten nicht darüber sprechen aber doch wissen, ob wir wegen dieser Sache Scherereien haben könnten.“
„Wie sahen die beiden aus?“ erkundigte sich der Beamte.
Die Wahrsagerin gab ihm eine sehr ins Einzelne gehende Beschreibung der Männer. Eine dieser Beschreibungen deckte sich haargenau mit dem Angaben der Schaffnersgattin und des Fabriknachtwächters.
Das war genug für den Kriminalbeamten. Als der Beamte mit seinen Informationen in die Polizeizentrale zurückkehrte, war das Signal zu fieberhafter Tätigkeit gegeben. Uniformierte Polizei- und Kriminalbeamte wurden in ganzen Wagenladungen nach Ybor City geschickt. Sie hatten Befehl, jeden verkommen aussehenden Menschen festzuhalten, auf den die gegeben Beschreibung irgendwie paßte. Noch vor Anbruch der Nacht waren etwa fünfundzwanzig Vagabunden bei der Polizeizentrale eingeliefert. Sie wurden verhört – und wenn auch widerstrebend – sah sich die Polizei doch genötigt, einen nach dem anderen wieder auf freien Fuß zu setzen, nachdem ihr Alibi nachgeprüft worden war. Die Polizei gab indessen die Hoffnung noch nicht auf. Die Wirte der Caféhäuser und Kneipen in Ybor City erhielten eine ausführliche Beschreibung des Gesuchten in die Hand gedrückt. Dann wartete man, ob sich etwas ereignen werde.
Zwei Tage später rief der Besitzer eines Caféhauses sehr eilig an und ersuchte um die Entsendung eines Kriminalbeamten. Man versuchte von ihm Näheres zu erfahren, er erklärte jedoch, er habe keine Zeit, es sei aber äußerst wichtig, ihm sofort einen Polizisten zu schicken.
Zwei Kriminalbeamte machten sich auf den Weg. Der Besitzer erwartete sie schon vor der Tür. „Gehen Sie ins Nebenzimmer“, sagte er. „Der Mann, der dort sitzt, entspricht in jeder Beziehung der Beschreibung des Mörders.“
Die Hand schußbereit am Revolver, stürzten die beiden Beamten in das kleine Nebenzimmer des Cafés. Ein ziemlich abgerissener Mensch saß allein an einem der Tische und starrte ins Leere. Sein Gesicht trug alle Spuren der Ausschweifung. Nach seine blutunterlaufenen Augen und seinem ganzen Äußeren zu urteilen, mußte er schon mindestens acht Tage durchgebummelt haben.
Als er aufblickte und einer der Beamten ihm seine Dienstmarke zeigte, huschte ein Ausdruck des Entsetzens über sein Gesicht. Zwei Revolvermündungen waren auf ihn gerichtet.
„Kommen Sie mit. Wir haben mit Ihnen zu reden!“
„Worüber?“
„Das werden Sie noch rechtzeitig erfahren.“
Fünfzehn Minuten später stand er in einem wahren Trommelfeuer von ausgeklügelten Fragen. „Wie heißen Sie?“
„Benjamin Levins.“ „Beschäftigung?“ „Ich bin, was ihr einen Vagabunden nennt.“
„Was wissen sie über die Ermordung der Familie Merrill?“ „Nichts.“
„Ein Mann, der auf ihre Beschreibung paßt, ist in der Mordnacht in der Nähe des Hauses der Merrill gesehen worden – und das waren Sie!“
„Nein, das war ich nicht.“
„Ziehen Sie Ihren Rock aus!“
Der Verhaftete gehorchte.
„Aha!“ sagte ein Detektiv, ihn bei einem seiner schmutzigen Hemdsärmel packend. „Was haben wie denn hier? Rote Flecken? Das ist Blut, was?“
„Nein! Rote Farbe!“
„Und doch ist es Blut!“
„Nein, es ist kein Blut, es ist Farbe.“
Und so ging es stundenlang weiter.
Gegen Abend wurde ein neuer Verdächtiger eingeliefert. Er schien Levins zu kennen. Man nahm ihn ins Verhör und er hatte gerade angegeben, er heiße Leonard Thompson, als die Wahrsagerin, die vorgeladen war, zufällig den Raum betrat. Ihre scharfen Augen flogen von einem der Verhafteten zum anderen. Dann wandte sie sich an den sie begleitenden Beamten und sagte: „Ja, das sind sie. Das sind die beiden Männer, die mich am Tage nach dem Mord aufgesucht haben.“
Die Polizei konnte jedoch aus den beiden nichts Vernünftiges herausbringen. Zu guter Letzt wurde Thompson, dessen Haltung in jeder Beziehung die eines Unschuldigen gewesen war, auf freien Fuß gesetzt. Er galt als vollkommen entlastet. Es war zwar nicht abzustreiten, daß er mit Levins zusammen die Wahrsagerin aufgesucht hatte, wie er jedoch behauptete, hatte er Levins während einer Bierreise kennengelernt, in der Betrunkenheit hätten sie Angst bekommen, wegen des Mordes, von dem überall die Rede war, verhaftet und fälschlich beschuldet zu werden. Deshalb hätten sie beschlossen, die Wahrsagerin zu befragen.
Levins, der nach wie vor von der Polizei unzähligen Verhören unterzogen wurde, bestritt gelassen, irgendetwas mit dem Mord zu tun zu haben. Er gab zu, bei der Wahrsagerin gewesen zu sein. Er hatte aber auch eine Erklärung dafür. Nach seiner Darstellung war er zufällig früher am Abend in der Nähe des Merrillschen Hauses gewesen, war von mehreren Leuten gesehen worden und hatte deshalb Angst, daß ihm die Bluttat in die Schuhe geschoben werden würde.
So schleppten sich die Dinge hin. Man kam nicht weiter. Das Publikum schäumte vor Entrüstung und schrieb alles der Unfähigkeit der Polizei zu. Die Erregung wurde schließlich so groß, daß sich die Behörden zu einem verzweifelten Versuch entschlossen.
In tiefster Nachtstille wurde Levins von zwei Kriminalbeamten in ein Polizeiauto geschafft. Man fuhr nach dem Städtischen Leichenschauhaus. In einem Raum, der zu dieser Nachtstunde noch unheimlicher wirkte, lagen die Opfer des letzten Mordanschlags auf langen Marmortischen. Man schlug die Tücher zurück, die sie verhüllten. Die grausam entstellten Gesichter starrten zur Decke empor. Levins wurde aufgefordert, den Toten ins Antlitz zu sehen. Er tat es. Die Beamten sagten ihm auf den Kopf zu, er sei derjenige, der diese Menschen erschlagen habe. Dann wurde er ins städtische Gefängnis zurückgeschafft.
Am nächsten Morgen erhielt auf irgendeine Art ein unternehmender Reporter Wind von dem nächtlichen Besuch im Leichenschauhaus. Seine Zeitung veröffentlichte die Behauptung, daß Levins gestanden habe. Kurz vor Mittag sammelten sich drohende Menschenmassen vor dem städtischen Gefängnis. Da man irgendeinen Gewaltakt fürchtete, wurde Levins schleunigst in ein Auto gesteckt und nach dem Bezirksgefängnis überführt, wo sich bessere Vorkehrungen zu seinem Schutz treffen ließen, als in dem kleinen städtischen Gefängnis. Das Ganze spielte sich an einem Sonntag ab. Bald war auch das Bezirksgefängnis das Ziel vieler, die sonst nichts zu tun hatten. Der Gedanke sich des Gefangenen zu bemächtigen und ihn kurzerhand aus eigener Machtvollkommenheit hinzurichten, tauchte zum ersten Mal auf. Je mehr die Zeit verrann, desto größer wurde die murrende und drohende Menge. Es fehlte nur noch der Führer, der die glimmenden Kohlen zu hellen Flammen entfachte. Und auch er sollte sich bald finden.
Mit wachsender Besorgnis sahen die Beamten im Gefängnis die herannahende Gefahr. Schließlich erschien einer von ihnen am Fenster und rief hinunter:
„Levins ist nicht hier! Er ist in eine andere Stadt transportiert worden.“
„Das lügst du in deinen Hals hinein!“ brüllte jemand aus der Menge. „Levins ist hier, und nirgends anders!“
Plötzlich knallte aus dem Dunkel ein Schuß. Es war wie ein Signal. Mehr Schüsse folgten. Die Menge feuerte auf das Gefängnis. Ein Hilfssheriff, der zufällig vor die Gefängnistür getreten war, wurde verwundet. Dann warfen sich die Anführer des Pöbels mit voller Wucht gegen die Gefängnistür. Der Sheriff, der mit seinen Beamten hinter der Tür stand, drohte ihnen mit lauter Stimme, daß er jeden erschießen werde, der versuche die Tür einzudrücken.
Für den Augenblick war die Gefahr behoben. Am anderen Morgen ließ der Sheriff, der für die folgende Nacht einen neuen Angriff auf das Gefängnis befürchtete, Levins in aller Stille in ein Auto bringen. Er wurde ins Gefängnis von Orlando transportiert, das etwa hundert Meilen nördlich von Tampa liegt. Da die Bevölkerung von Orlando als weniger erregbar und zu Gewalttätigkeiten neigend galt, war anzunehmen, daß Levins dort keine Lynchjustiz zu fürchten habe.
In Tampa war es völlig unbekannt geblieben, daß Levins in ein anderes Gefängnis überführt worden sei. Kaum war die Dämmerung eingetreten, als viele Hunderte sich schon auf den Weg zum Gefängnis machten. Die meisten waren mit Revolvern und Jagdflinten bewaffnet. Das drohende Murren nahm an Umfang und Stärke immer mehr zu, bis es straßenweit in der Umgebung des Gefängnisses zu hören war. Der Sheriff trat auf die Eingangstreppe des Gefängnisses hinaus, obwohl er sehr genau wußte, daß er dabei sein eigenes Leben riskierte, und versuchte, die Leute zur Vernunft zu bringen. Er predigte tauben Ohren.
„Liefere Levins aus, oder wir bringen dich auch um!“ brüllte jemand.
Der Sheriff, der begriffen hatte, daß die Lage hoffnungslos sei, sandte einen dringenden Hilferuf an den Gouverneur von Florida und bat um die Entsendung einer Kompagnie Miliz. Der Gouverneur entsprach dem Wunsch. Die angeforderten Truppen wurden in aller Eile nach Tampa transportiert. Ehe sie jedoch eintreffen konnten, hatte die Menge bereits den Versuch gemacht, das Gefängnis zu stürmen. Auf beiden Seiten waren Schüsse gefallen. Acht Personen waren verwundet worden, zum Teil Gefängnisbeamte, zum Teil Leute aus der Bürgerschaft.
Die Erregung der Angreifer hatte sich bis zur Siedehitze gesteigert. Das Eintreffen der Miliz verhinderte jedoch weitere Zusammenstöße, deren Folgen nicht abzusehen gewesen wären.
Am nächsten Tag glaubte der ordnungsliebende und solide Teil der Bürgerschaft endlich freier atmen zu können. Die Miliz hielt sämtliche Straßen in der Umgebung des Gefängnisses besetzt und schickte starke Patrouillen aus. Die drohenden Pöbelmassen schienen endgültig zerstreut. Aber wie sehr hatte man sich getäuscht! Schon lange vor Beginn der Dämmerung bildeten sich kleine Gruppen an den Straßenecken, in Kneipen und Zigarrenläden. Sie unterhielten sich flüsternd. Die meisten waren bewaffnet. Als es dunkel geworden war, brach eine dichtgeschlossene Gruppe von etwa tausend Mann, die sich in einer der Seitenstraßen in der Umgebung des Gefängnisses in aller Stille formiert hatte, im Laufschritt gegen das Gefängnis vor. Alle waren fest überzeugt, daß Levins noch hinter seinen Mauern zu finden sei.
Die Nationalgardisten, die das Brüllen der Menge in der Ferne hörten, spähten besorgt in die Finsternis. Sie trauten ihren Ohren nicht, als sie die verschwommenen Umrisse der gegen sie heranbrausenden menschlichen Flutwelle gewahrten.
„Wir rennen sie einfach über den Haufen!“ brüllten sich die Angreifer aufmunternd zu. „Die wagen ja gar nicht zu schießen! Das ist ja alles Bluff!“
Sie hatten die schwache Miliztruppe schon beinahe erreicht. Auf einen Soldaten kamen mindestens zwanzig Angreifer. Die heranstürmende Menschenflut drohte sie gegen die Mauern des Gefängnisses zu pressen. Hier war nur noch eines möglich: und die Soldaten taten es. Sie nahmen Stellung an ihren Maschinengewehren, die rund um das Gefängnis aufgestellt waren.
Aber die Menge war nicht mehr zu halten. Die Vernunft war mit ihnen durchgegangen. Faustschläge trafen die Nationalgardisten ins Gesicht. Dann kläffte ein Maschinengewehr. Einer der Angreifer stürzte tot zu Boden, dann ein anderer, dann ein dritter. Zahlreiche Schüsse aus der Schar der Angreifer, die jetzt einer Armee von Tobsüchtigen glich! Und nun setzte gellend, nervenzerreißend, das Stakkatohämmern der Maschinengewehre ein. Die Truppen hatten auf der ganzen Linie das Feuer eröffnet. Die vorderste Reihe der Angreifer war zur Hälfte niedergemäht.
Im Handumdrehen war der Pöbelhaufen wie eine erschreckte Herde auseinandergestoben. Angesichts der Toten und Verwundeten war ihre Kampflust verraucht. Sie räumten den Ärzten und Krankenschwestern das Feld, die gleich darauf in ihren weißen Kitteln sich um die Opfer des Zusammenstoßes bemühten. Die Nationalgardisten standen nach wie vor auf ihren Posten.
Levins war noch immer in Sicherheit drüben in Orlando. Beschämt schlich das geschlagene Heer der Unvernunft nach Hause. Es hatte sechs Tote und vierzig Verwundete auf dem Pflaster gelassen.
Am folgenden Tag nahm der Sheriff fünfhundert angesehenen Bürgern den Diensteid als Hilfspolizisten ab. Ihre Aufgabe war es, die Straßen in der Umgebung des Gefängnisses abzupatrouillieren, und den Rest des Pöbelhaufens ins Gewissen zu reden, die sich noch hier und da herumtrieben und sich in Drohungen gegen die Truppen ergingen, auf die sich jetzt ihr ganzer Haß konzentrierte. All diese Drohungen zerrannen übrigens in Nichts.
Es trat dann eine eigentümliche Wendung des Falles ein, die unverhoffte Resultate zeitigte. Die Behörden beschlossen, eine Reihe von Kriminalbeamten, denen sich verschiedene Zeitungsberichterstatter anschlossen, nach Orlando zu entsenden, um Levins einem neuen Verhör zu unterziehen. Ihn nach Tampa zurückzubringen, wagte man nicht. Diese Maßregel fand allgemeinen Beifall, da sie endlich die Fortsetzung der Vernehmung ermöglichte.
Am 7. Juni machte sich die Abordnung auf den Weg nach Orlando. Als Levins der Abordnung vorgeführt wurde, machte er ein seltsames Gesicht. Er wußte nicht recht, wie er die Sache auffassen sollte. Dann machte ihm jemand eine Andeutung, daß man ihn nach Tampa zurückbringen werde, wenn er nicht endlich mit der Wahrheit herausrücke. – Die Polizei hat nachher energisch bestritten, sich dieses Kunstgriffes bedient zu haben, jedenfalls aber ist die Tatsache in ganz Tampa bekannt, daß eine derartige Äußerung gefallen ist. Sie hatte aber auch einen unverhofften Erfolg. Denn wenn es etwas gab, wovor Levins wirklich Angst hatte, so war es der Gedanke, dem Tampaer Pöbel in die Hände zu fallen.
Auf irgendeine Art hatte er von den Ausschreitungen in den Straßen vor dem Gefängnis erfahren.
Und deshalb legte er jetzt ein Geständnis ab.
„Ja“, erklärte er, von Schluchzen geschüttelt – denn seine überraschende Kaltblütigkeit war jetzt spurlos verschwunden – „wir haben die Familie Merrill ermordet, aber es war ein schrecklicher Irrtum. Nach der Tat steckte ich ein Streichholz an und besah mir die Leichen. Da erst merkte ich, daß ich keinen von den Leuten kannte, die wir getötet hatten. Wir hatten nicht die richtigen ermordet.“
„Sie sagen immer ‚wir‘. Was meinen Sie damit?“ fragte einer der Beamten.
„Leonard Thompson – der Kerl den sie frei gelassen haben – war mit dabei. Er hat Ralph und Wallace Merrill erschlagen.“
Sofort wurde telephonische Weisung nach Tampa gegeben, Thompson wieder zu verhaften.
In Fortsetzung von Levins Geständnis, das allgemeine Verblüffung auslöste, erklärte er dann weiter: „Meine Absicht war eigentlich, Frank Rowell zu beseitigen – er war mit den anderen Rowells ja verwandt, und es war mir zu Ohren gekommen, daß er mich für den Mörder von Bee Rowell und seiner Familie hielt. Nun, damit war er ja nicht im Unrecht, aber ich hatte keine Lust, mich festnehmen zu lassen. Ich dachte, wenn ich ihn um die Ecke bringe, wird es nie herauskommen, wer vor einem Jahr Bee Rowell und seine Angehörigen ermordet hat.“
Man befahl ihm, sich ausführlicher über den Mord in Bee Rowells Haus zu äußern.
Dazu erklärte Levins:
„Ich war wie verrückt nach Frank Rowells Frau. Sie aber wollte von mir nichts wissen. Als mir das so eine Weile durch den Kopf gegangen war, dachte ich, ich werde noch einmal zu ihr hingehen und ein Wörtchen mit ihr reden. Also suchte ich nachts das Rowellsche Haus auf. Der erste, an den ich geriet, war der Untermieter Alexander. Ich fragte ihn, wo Frau Rowell sei, und er antwortete: ‚sie wohnt gar nicht mehr im Haus.’ Nun, ich hatte die ganze Zeit über schwer getrunken und auch gekokst – und gerade in der Woche ganz besonders. Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig geworden. Ich muss glattweg den Verstand verloren haben. Als der Kerl mir sagte, Frau Rowell sei gar nicht mehr da, wurde ich wütend und brachte ihn um. Dann ging ich von Zimmer zu Zimmer und machte jeden kalt, der mir zu Gesicht kam.
Am nächsten Tag las ich in den Zeitungen von der Sache. Der Boden wurde mir in Tampa zu heiß, und ich fuhr nach Miami.
Später lernte ich Thompson kennen und erzählte ihm von der Geschichte. Wenn wir betrunken waren, zog er mich damit auf und behauptete, Frank Rowell hätte auf mich einen Verdacht und würde mich noch eines Tages auf den elektrischen Stuhl bringen. Nun, das ließ mir keine Ruhe. Schließlich schlug ich Thompson vor, Frank Rowell aus der Welt zu schaffen. Thompson ging darauf ein, und wir führten die Sache aus. Erst als alles vorbei war, entdeckte ich meinen Irrtum. Ich habe die Merrills nicht einmal vom Aussehen gekannt. Die Rowells waren in der Zwischenzeit ausgezogen. Davon hatte ich natürlich keine Ahnung gehabt.“
Thompson war mittlerweile wieder verhaftet worden. Er bestritt auch diesmal mit aller Energie, irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben und behauptete hartnäckig, Levins versuche nur, ihn mit allen Mitteln in die Affäre hinein zu verwickeln.
Einige Wochen später wurde Levins in aller Stille nach Tampa zurückgebracht, um vor Gericht gestellt zu werden. Mit Rücksicht auf die Volksstimmung wurde der Gerichtssaal für die Öffentlichkeit gesperrt. Nur eine geringe Anzahl Zuhörer wurde gegen Eintrittskarten zugelassen. Levins Bekenntnis, das er in Orlando abgelegt hatte, war selbstverständlich in die Akten mit aufgenommen worden. Am dritten Prozeßtag versuchte die Verteidigung dieses Geständnis zu erschüttern – (nach amerikanischem Recht kann der Angeklagte als Zeuge in eigener Sache vernommen werden) – der Verteidiger bestand darauf. Levins, der einen sehr viel frischeren und gesünderen Eindruck machte als zur Zeit seiner Verhaftung, gab eine vollkommen neue Darstellung der blutigen Ereignisse. Er behauptete nunmehr, er sei mit Thompson zusammen nach einer langen Kneiptour bei den Merrills eingestiegen, nur um einen Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Plötzlich habe ihn jemand aus dem Dunkel angebrüllt: „Was tut ihr hier?“ Gleich darauf sei es zu einem Kampf gekommen. Er gab zu jemanden umgebracht zu haben und tat sein Möglichstes, um Thompson mit in die Angelegenheit hineinzuziehen. Er bestritt jedoch energisch, daß die Bluttat vorbedacht gewesen sei. Bei den Geschworenen hatte er damit allerdings kein Glück. Sie sprachen Levins „Schuldig des vorsätzlichen Mordes“.
Einige Wochen später wurde Leonhard Thompson vor Gericht gestellt. Der Prozeß nahm eine überraschende Wendung. Levins, der als Hauptbelastungszeuge fungieren sollte, bestritt plötzlich energisch, daß Thompson in der fraglichen Nacht auch nur in die Nähe des Merrillschen Hauses gekommen sei.
Thompson wurde frei gesprochen.
Levins, der zum Tode verurteilt worden war, wurde am 22. November 1927 um ein Uhr achtundvierzig nachmittags, im Staatsgefängnis zu Raifold hingerichtet.
Er zeigte keine Spur von Erregung. Als man ihn auf den elektrischen Stuhl schnallte, verlangte er nicht begnadigt zu werden und gab auch vor seinem Tode keine weiteren Erklärungen ab. Er schien sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben.
Quelle:
Frank A. Ingraham: Das Nachtgespenst von Tampa. In: Wahre Detektiv Geschichten. 1. Jahrgang. Nummer 12. Berlin, 6. September 1930, S. 22-32.
1 Stadt an der Westküste Floridas.