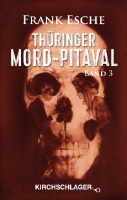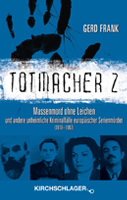Papa Lucien Lamarre war zwar ein wenig kurzsichtig und litt an Rheumatismus, sonst aber war er noch stramm und tapfer auf den Beinen, einer der verläßlichsten Beamten der Urban-Versicherungs-Gesellschaft, für die er im Bezirk Kremlin-Bicétre, einem Außenbezirk von Paris, auf dem linken Seineufer, von Haus zu Haus ging, um die fälligen Beiträge einzuziehen. Zehn Jahre über hatte sein Tagwerk den gleichen monotonen und regelmäßigen Verlauf genommen.
Pünktlich um neun Uhr morgens verließ er sein schäbiges, möbliertes Zimmer im dritten Stock, um sich auf seinen Rundweg zu begeben, den er genau und methodisch abwickelte. Abends um zehn Uhr kehrte er zurück, und zwar wieder mit solcher Pünktlichkeit, daß Madame Saupin, seine Wirtin, sich angewöhnt hatte, ihre Uhr danach zu stellen, denn genau auf dieselbe Minute hörte sie ihn heftig schnaufend die ächzende Treppe heraufkommen. Regelmäßig machte er auf dem ersten Treppenabsatz eine Pause, um seiner Wirtin durch die Tür ein freundliches Guten Abend zuzurufen. Ob schönes, ob schlechtes Wetter, an Lamarres Tageslauf änderte es nichts. Es war an sich eine recht überraschende Sache, daß er seine Zeit so genau einzuhalten vermochte, weil seine Dienstgänge ihn jeden Tag der Woche in eine Richtung führten.
An einem Dezemberabend – es sind inzwischen schon einige Jahre vergangen – kehrte Lamarre nicht um zehn Uhr abends zurück. Auch als es elf schlug, hatte er sich nicht eingestellt. Madame Saupin lag wach in ihrem Bett und horchte hinaus, ob sie nicht endlich den etwas unsicheren Schritt ihres Mieters auf der Treppe vernehmen könne. Schließlich fiel sie in einen unruhigen Schlaf, in dem sie von häßlichen Träumen gepeinigt wurde.
Lamarre war auch während der Nacht nicht zurückgekehrt. Bei Madame Saupin hatte sich im Laufe der Zeit eine stille Zuneigung für ihren langjährigen Mieter entwickelt. Deshalb machte sie sich den ganzen folgenden Tag – es war ein Sonntag – über ihn Sorgen. Am Montagmorgen konnte sie die Ungewißheit nicht länger ertragen. In hysterisch aufgelöstem Zustand erschien sie im Büro der Versicherungsgesellschaft. Dicke Tränen strömten über ihr faltiges Gesicht als einer der leitenden Beamten, ein etwas großspuriger Herr mit einem gewaltigen Schnurrbart, sie in sein Zimmer führte.
„In zehn langen Jahren“, schluchzte sie, „ ist es niemals vorgekommen, daß Lamarre nicht pünktlich um zehn Uhr das Haus betreten hat. Es war ja sein Heim. Sie müssen wissen, daß alle seine Verwandten und Familienangehörigen bereits tot sind. Ich fürchte, daß ihm irgendetwas Entsetzliches zugestoßen ist.“
Der Generalagent nickte. „Da haben Sie gewiß recht, Madame, und ebenso scheint unserem Geld etwas zugestoßen zu sein, das Lamarre bei sich trug. Ich denke, die Polizei wird sich mit der Sache beschäftigen müssen.“
Eine Stunde später betrat der Generalagent das Polizeirevier und wandte sich an den diensttuenden Beamten.
„Wir sind in größter Sorge“, erklärte er unter anderem, „weil Lucien Lamarre heute etwa sechzehn- bis siebzehntausend Francs bei unserer Kasse hätte einzahlen müssen, die er während seiner Dienstgänge in der vergangenen Woche bei unseren Versicherungsnehmern einzuziehen hatte.“
„Das“, meinte der diensthabende Wachtmeister, „ist keine so ungewöhnliche Geschichte. Es wäre durchaus nichts Sonderbares, daß unser guter alter Freund irgendwo ein hübsches Gesicht gesehen, daß er die Last der Jahre abgeschüttelt und für all das Geld eine amüsantere Verwendung gefunden hätte, nicht? Sie wissen ja auch, daß alte Narren die schlimmsten sind.“
Diese weise Bemerkung veranlaßte den Besucher zu einem melancholischen Nicken.
„Machen Sie sich nicht allzuviel Kopfzerbrechen“, meinte der Polizeibeamte, „wir werden im Handumdrehen den alten Duckmäuser hinter Schloß und Riegel haben.“
In diesem Augenblick verließ Kriminalkommissar Maurice Lepine, einer der besten Kriminalisten, die Europa je gehabt hat, seinen Dienstraum. Er nickte dem Wachtmeister kurz zu, grüßte mit etwas mehr Förmlichkeit den ihm unbekannten Besucher und war gerade dabei, das Revier zu verlassen, als der Diensthabende ihn zurückrief, und ihm kurz berichtete, was vorlag. Lepine gab ein paar Anweisungen. Es handelte sich um die Einleitung der üblichen Schritte zur Auffindung Lamarres.
Als Lepine spät am Nachmittag zurückkam, wurde ihm eine schriftliche Meldung über die Umstände des Verschwindens Lamarres vorgelegt. Er las sie gelassen durch und richtete dann an den Beamten, der ihm den Rapport gegeben hatte, mehrere Fragen. Lepine war nicht der Mann voreiliger Schlußfolgerungen. Er vertiefte sich sofort in seinen liebsten Zeitvertreib, nämlich in jeder einzelheit anderer Meinung zu sein, als ein Untergebener.
„Für mich steht es noch keineswegs fest, daß Lamarre ein Betrüger ist. Im Gegenteil! Ich bin durchaus der Überzeugung, daß er ermordet wurde.“
„Ermordet?“
Lepine nickte.
„Nun hören sie einmal gut zu“, sagte er. „Scheint es ihnen wirklich nicht angebracht, die fadenscheinige Theorie, daß eine Unterschlagung vorliegt, auf einen derart alten und methodisch veranlagten Mann anzuwenden, der auf zehn Jahre treue Dienste zurückblicken kann? Er ist alt und rheumatisch, ein ausgesprochener Gewohnheitsmensch. Und was einem einmal zur Gewohnheit geworden ist, das wird man so rasch nicht los, verehrter Freund. Wenn Lamarre geplant hätte, einmal mit einer größeren Summe zu verschwinden, so hätte sich die Veränderung in seinem Charakter auch durch gewisse äußere Zeichen angekündigt. Haben Sie sich schon erkundigt, ob er ein Bankkonto hat?“
Der Beamte errötete.
„Ich werde sofort das Nötige tun“, erklärte er seinem Vorgesetzten.
Zwei Stunden später mußte der aus allen Wolken fallende Wachtmeister feststellen, daß Lucien Lamarre auf einer Bank in nächster Nähe seiner Wohnung ein Gutahben besaß. Es belief sich auf 50.000 Francs und war unangetastet.
„So“, sagte Lepine, „da haben Sie den Beweis dafür, daß 17.000 Francs den Mann nicht ohne weiteres in Versuchung führen konnten. Ich fürchte immer mehr, daß wir es mit einem Mord zu tun haben.“
Trotzdem überließ Lepine, wenigstens wenn man dem äußeren Anschein trauen durfte, die Angelegenheit sich selbst, das heißt der Erledigung auf dem üblichen Dienstweg. Als aber mehrere Tage vergingen und die auf ganz Paris sich erstreckenden Erkundigungen keinerlei Spur des Vermißten ergaben, sah sich Lepine veranlaßt, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen.
Lepine hatte es natürlich mit einem besonders schwierigen Problem zu tun. Es gab auch nicht die geringste Spur von Anhaltspunkten, an die man hätte anknüpfen können. Aber schwierige Fälle waren Lepines Spezialität. Obwohl er zu dieser Zeit in seinem Fach noch nicht hervorgetreten und damals noch gänzlich unbekannt war, war Lepine damals schon gewiß ein ausgezeichnet geschulter Beamter, ein Mann mit Bildung, der zwar manchmal etwas akademisch wirkte, aber eine Schlauheit besaß, die er unter seinem gravitätischen Benehmen und der ihm angeborenen Kultiviertheit gut zu verbergen wußte. Eine andere Eigenheit, die ihn besonders charakterisierte, war sein Vorstellungsvermögen, auf das viele seiner hervorragenden Leistungen zurückzuführen sind. Es war ein Vorstellungsvermögen, das er mit kalter Logik und angewandter Psychologie zu zügeln verstand. Er begünstigte das, was er als „das einfachste System“ zu bezeichnen pflegte. Seine Methode bestand unveränderlich darin, alle wichtigen Daten und Angaben zu sammeln und zu arrangieren. Wo er in diesem Gefüge Löcher und Spalten entdeckte, füllte er sie mit fein ausgeklügelten Hypothesen und schaffte sich so das tragende Gerüst für seine Theorie.
Eine seiner bezeichnendsten Gewohnheiten war die Art, mit der er mit seinem Bleistift spielte und kleine geometrische Figuren zeichnete, wenn er seine Gedanken auf etwas zu konzentrieren hatte. Auch im Fall Lamarre vertiefte er sich zunächst in eine ruhige Prüfung der vorliegenden Tatsachen, deren Zahl erbärmlich klein war. Er kam zu der Auffassung, daß sich der Schlüssel des Rätsels vielleicht finden lasse, wenn man Lamarres letzten Lebenstag zu rekonstruieren versuche.
Zunächst sprach er beider Versicherungsgesellschaft vor und ließ sich die vollständige Liste derjenigen Versicherungsnehmer geben, bei denen Lamarre Gelder einzuziehen hatte. Die Liste war in sechs Abschnitte eingeteilt, einen für jeden Tag der Woche. Die fünf ersten Abschnitte legte Lepine ohne weiteres beiseite. Ihn interessierte nur der sechste, der die Namen und Adressen der Leute enthielt, die Lamarre an dem fraglichen Sonnabend zu besuchen hatte.
Dann kehrte Pepine auf das Revier zurück und forderte den Wachtmeister auf, ihn in Lamarres Wohnung zu begleiten. Madame Saupins Schmerz hatte sich im Laufe der Zeit etwas beruhigt. Sie wurde vernommen. Es ergab sich, daß Lamarre niemals verheiratet war, daß er ein gelassener und schweigsamer Mensch mit geringen Lebensansprüchen gewesen war – mit einem Wort, ein Gewohnheitsmensch, wie Lepine bereits vorausgesagt hatte. In seinem Leben war kein dunkler Punkt und es ergaben sich auch nicht die geringsten Anzeichen dafür, daß in seinem Charakter in der letzten Zeit eine verhängnisvolle Wandlung vorgegangen sein könne. Sparsam bis zur Kleinlichkeit, wie er von je gewesen war, stellte er gewiß nicht den Typus dar, dem man es zutrauen konnte, plötzlich und unversehens über die Stränge zu schlagen. Über die Einzelheiten seiner täglichen Gänge wußte Madame Saupin nichts.
Lepine und sein Untergebener kletterten zu Lamarres Zimmer m dritten Stockwerk hinauf, wo Lepine sich am Tisch niederließ und in das andächtige Studium eines Straßenplans des Kremlin-Bicétre-Bezirks versank, wobei er neben sich die Namen und Adressen derjenigen Kunden liegen hatte, die Lamarre am Sonnabend zu besuchen pflegte.
Schließlich zog Lepine einen kleinen Zirkel aus der Tasche, beschrieb damit an einer gewissen Stelle einen Kreis auf der Karte und wandte sich dann an den Wachtmeister.
„Ich bin im Begriff, mir aus diesem Plan eine Spezialkarte herauszuschneiden. Eine Skizze des Weges, den der alte Mann genommen hat, ergibt ungefähr den Teil der Karte, der in Betracht kommt.“
„Aber wozu soll das gut sein?“ erkundigte sich der noch junge Untergebene.
„Narr, Sie!“ rief Lepine ungeduldig. „Begreifen Sie denn nicht? Wenn ich eine solche Karte habe, hab eich auch ungefähr den Umkreis festgelegt, innerhalb dessen sich der Schauplatz des Mordes an Lamarre befinden muß!“
„Sie sind ganz sicher, sie bauen fest darauf, daß ein Mord vorliegt!“
„Aber ganz gewiß!“
„Aber warum, wieso können Sie das mit solcher Bestimmtheit behaupten?“
Lepine betrachtete den Fragesteller mit ausgesprochenstem Mißfallen.
„Können Sie nicht logisch denken?“ fragte er endlich. „Sonnabend ist der letzte Tag der Woche, und da Lamarre das von ihm einkassierte Geld nur einmal wöchentlich abzuliefern pflegte – nämlich am Montag – ist es natürlich, daß er Sonnabends eine beträchtliche Summe bei sich herumtrug, die hinreichte, um einen verbrecherisch veranlagten Menschen in Versuchung zu führen. Und wem konnten die Verhältnisse am ehesten bekannt sein? Doch gewiß nur jemandem, der selbst bei der Gesellschaft versichert war.“
„Da stimmt“, räumte der Wachtmeister niedergeschlagen ein.
Lepine schien von diesem Augenblick an die Gegenwart des anderen vergessen zu haben und versank ganz und gar in das Studium seiner Karte, während der Wachtmeister gelangweilt auf Lamarres Bett saß. Schließlich brach Lepine auf, um, begleitet von seinem Untergebenen, in systematischer Reihenfolge die auf Lamarres Liste verzeichneten Personen aufzusuchen. Dieser Ausflug erwies sich zunächst als vollkommener Fehlschlag. Nirgends waren auch nur die geringsten verdächtigen Anzeichen festzustellen. Die Versicherungsnehmer in diesem Vorstadtbezirk waren nicht gerade leicht zu durchschauende Menschen. Es waren alles wenig mitteilsame und anscheinend recht gerissene Leute, die über einen polizeilichen Besuch keineswegs erfreut waren. Außerdem gehörten sie einem erwerbsgierigen Menschenschlag an. Sie begriffen sehr gut, daß ihnen viele kostbare Arbeitsstunden verloren gehen würden, wenn sie sich auf Redereien einließen, daß sofort eidesstattliche Versicherungen, Vorladungen und ähnliche gesetzlichen Umständlichkeiten sich einstellen würden. Es schien ihnen daher wohl richtiger, möglichst den Mund zu halten.
Alle gaben indessen ohne weiteres zu, daß Lamarre an dem fraglichen Sonnabend bei ihnen gewesen war. Daran konnten sie sich deutlich erinnern. Sie konnten auch die betreffenden Quittungen vorweisen. Besonders lebhaft erinnerten sie sich, daß der alte Mann infolge des Regenwetters völlig durchgenäßt gewesen war. Von einer Haustür zur anderen war er mit geöffnetem Regenschirm gewatschelt, einem so dünnen und abgenutzten Regenschirm, daß das Wasser einfach durch den Stoff lief.
Unverrichteter Dinge kehrten die Beamten zu Madame Saupin zurück, wo Lepine sich erneut in seine Karte vertiefte. Er machte sich Notizen, verfolgte mit dem Bleistift die Straßenzüge innerhalb des von ihm beschriebenen Kreisbogens und sagte dann zu dem Wachtmeister:
“Lamarre war ein alter Mann. Er litt an Rheumatismus. Das Laufen war ihm kein besonderer Genuß. Bei kaltem, regnerischem Wetter ist das Gehen für Leute mit Rheumatismus geradezu eine Qual. Lamarre hatte einen weiten Weg zurückzulegen. So lang war seine Route, daß er, wie Madame Saupin uns berichtete, sich für mittags etwas einsteckte, das er unterwegs im Gehen verzehrte, um nicht die kostbare Zeit in Kaffeehäusern verlieren zu müssen. Zehn Jahre lang war das seine Gewohnheit. Er war wahrscheinlich kein mit besonderen Geistesgaben ausgestatteter Mensch, aber zumindest war er intelligent, da er mit Geld umgehen konnte und auch eine Art von Buchführung verstehen mußte. Daraus folgt, daß er, insbesondere bei seinem methodischen Charakter, sich im Laufe der Jahre für seine Gänge eine bestimmte Route ausgearbeitet haben muß und natürlich den kürzesten und einfachsten weg, den Weg, auf dem er insbesondere bei kaltem, feuchtem Wetter, seinen armen rheumatischen Knochen so viel als möglich ersparen konnte.“
„Logisch ausgezeichnet“, meinte der Wachtmeister. „Aber was folgt daraus?“
„Folgendes:“ sagte Lepine kurz angebunden. Er zog einen Bleistift aus der Tasche und deutete auf die Karte. In wenigen Sekunden hatte er eine Linie durch die wichtigsten Verkehrsadern gezogen, wobei er insbesondere eine lange Straße berücksichtigte, die in schräger Richtung verlaufend, beinahe bis zum Haus der Madame Saupin führte.
„Wie Sie sehen“, erklärte er, „ist die Karte im Maßstab 1:50000 entworfen.“
Nun folgte eine Übungsaufgabe in topographischer Geometrie. Dem Resultat hafteten gewisse Voraussetzungen an, immerhin läßt sich sagen, daß es viel versprechende Möglichkeiten zu bergen schien. Es kam auf Folgendes heraus: In Anbetracht des schlechten Wetters und in dem Bestreben, sich von einem Punkt seines Dienstganges und zurück nach seiner Wohnung, möglichst des kürzesten Weges zu bedienen, mußte Lamarre mit ziemlicher Sicherheit die schräg verlaufende Rue Michelet entlang gegangen sein, weil er damit viele Ecken abschnitt. Die Rue Michelet stößt mit einem Ende an den berüchtigten Befestigungsgürtel. Nachdem Lepine so, bildlich gesprochen, Lamarre in die Rue Michelet platziert hatte, war der nächste Schritt, den Versicherungsnehmer ausfindig zu machen, der in dichtester Nähe wohnte.
„Der am dichtesten benachbarte Versicherungsnehmer“, teilte Lepine seinem Gefährten zur Aufklärung mit, „ist, wie man vernünftigerweise annehmen muß, derjenige, dem Lamarre an diesem Tag den letzten Besuch abstattete. Da wir bereits feststellten, daß er bei allen Versicherungsnehmern vorsprach, ergibt sich daraus ganz zwanglos, daß ihm bis zum letzten Besuch nichts geschehen ist. Nur“ murmelte er vor sich hin, „wollen wir einmal sehen – ah“, die Bleistiftspitze machte an dem Punkt halt, der die Wohnung von Martin Carara bezeichnete.
Lepine hatte im Verlauf seiner Nachforschungen natürlich auch hier einen Besuch abgestattet. Beide Beamten hatten sich lange mit Carara unterhalten, schien dieser doch den alten Lucien Lamarre gut gekannt zu haben. Carara und seine Frau Madeline, di ein einem uralten baufälligen Haus wohnten, erwarben ihren Lebensunterhalt auf eigentümliche Weise. Der Beruf, dem der alte Carara nachging, war ihm, wie Lepine meinte, ohne Zweifel bereits von seinen Vorvätern überkommen. Der Name Carara war eine Weiterbildung des französischen Wortes carriers, das Steinbrucharbeiter bedeutete.
Die Bezeichnung geht schon auf jene Arbeiter längst vergangener Tage zurück, unter deren Hacke die ersten Anfänge des tiefen und furchteinflößenden Schlundes entstanden, über dem Carara und Madeline jetzt hausten. Carara war von der Gemeinde als Hüter der riesigen Katakomben angestellt, die sich als dunkles Labyrinth tief unter den menschlichen Niederlassungen hinzogen. Ursprünglich waren diese Irrgänge nichts anderes gewesen als unterirdische Steinbrüche. Ein großer Teil des Baumaterials, aus dem die Pariser Häuser errichtet sind, ist dort unten gebrochen worden.
Schon vor langen Jahren wurden diese Brüche als erschöpft aufgegeben. Man machte aber nie den Versuch, diese Höhlungen wieder zu füllen. Schon im Jahre 1786 hatte ein Regierungsbeamter einen Einfall gehabt, den er für besonders glänzend hielt. Auf amtliche Anordnung waren die Gänge und Höhlen in ein großes offizielles Beinhaus verwandelt worden. Je mehr Paris wuchs, desto mehr Friedhöfe mußten diesem Ausdehnungsbedürfnis weichen. Auf amtliche Anordnung wurden die Gräber geöffnet, die Gebeine gesammelt, in ziemlich summarischer Weis ein Karren weggebracht und in die Katakomben geschüttet. Jahr um Jahr lieferten seitdem, je mehr Paris wuchs, alte Friedhöfe ihren Beitrag zu dieser grausigen Sammlung, bis schließlich mehr als 130.000 Gräber ihre Gebeine hergegeben hatten, um die unterirdischen, von einem Pesthauch durchwehten Kammern zu füllen.
Monate und monate harter, ekelerregender Arbeit und ganze Scharen von Tagelöhnern waren nötig, dieses fürchterliche Chaos zu klären und die Gebeine in systematischen Stapeln längs der feuchtglitzernden Wände aufzuschichten. Die Katakomben verwandelten sich in eine einzige Schreckenskammer. Auch in neuester Zeit wurden noch, wenn wieder die Beseitigung eines Friedhofes notwendig geworden war, die Gebeine ausgegraben und in die Katakomben geschickt.
Zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Hüter dieser grausigen Überreste verfiel Carara während seiner Streifzüge durch die dunklen Gänge auf den Gedanken, daß dieser Überfluß an menschlichen Gebeinen sich doch noch nutzbringend verwenden lasse. Wenn aus Tierknochen brauchbarer Dünger hergestellt werden konnte, warum sollte dann dasselbe nicht auch bei Menschenknochen der Fall sein? Carara begriff, daß hier in den dunklen Tiefen, in die nie ein Sonnenstrahl kam, der geeignete Platz sei, um eine Champignonzucht anzulegen. Nachdem er sich die Sache eine Weile durch den Kopf hatte gehen lassen, beschloß er tatsächlich, die Sorge um die Überreste seiner dahingegangenen Mitmenschen in den Hintergrund zu schieben und dafür sich an der Champignonzucht im großen Stil zu versuchen.
Er versprach sich davon eine angenehme Ablenkung von dem ewigen Anblick der Schädel und Knochen. Was kam es schon darauf an, ob die mürben Gebeine längst dahingeschiedener großer Patrioten sich mit denen verschollener Bettler in der alles gleichmachenden Knochenmühle vermischten, um dann zu Staub gemahlen, auf die langgestreckten Champignonbeete verstreut zu werden?
Carara wurde mit der Zeit zu einem regelrechten Unternehmer, der den feinen Cafés und Restaurants die Champignons lieferte. Seine verblüffend schöne Frau, Madeline, bewies sich dabei als verständnisvolle Helferin. Dank ihrer gemeinsamen Fürsorge wuchsen die kleinen weißen Pilze im Überfluß.
Der Zugang zu den Katakomben befand sich auf Cararas Hof. Ein Schacht mit einer langen Leiter führte in die Tiefe hinab. Jeden Morgen erschien Carara auf den obersten Sprossen dieser Leiter und förderte einen Korb mit Champignons nach dem anderen ans Tageslicht. Madeline brachte die Ware in die Stadt, verkaufte sie und zahlte, bevor sie den Heimweg antrat, das Geld auf der Bank ein. Auf diese Art kamen die Cararas zum Wohlstand. Sie waren in der Lage, ihren Kindern – sie hatten zwei Mädchen und einen Jungen – alles mögliche Gute zuzuwenden. Aber obwohl sie Geld verdienten, lag ein Fluch auf ihrem Leben.
Alle Kinder in der Nachbarschaft zogen sich ängstlich vor dem Umgang mit den Sprößlingen der Cararas zurück. Cararas Nachbarn zeigten sich ihm gegenüber unfreundlich und gehässig. Sie betrachteten den Katakombenaufseher als angehörigen einer niederen Kaste. Niemand traute sich ohne ein gewisses Grauen in die Nähe seiner Wohnung. Martin Carara und seine ganze Familie galten als geächtet. Nicht etwa, weil die Bewohner des Kremlin-Bicétre-Bezirks sich besonders vornehm dünkten, sondern weil sie sich von Aberglaube und Angstvorstellungen leiten ließen. Dies ging Madeline Carara und ihrem Mann sehr zu Herzen. Insbesondere um der Kinder willen. In einer Art innerer Notwehr steckten sie die Ziele ihres Ehrgeizes umso höher.
„Gedulde dich nur ein bißchen“, pflegte Carara seiner Frau zu wiederholen, „und dann haben wir genug. Dann, mein Liebling, wandern wir nach Italien aus und denken mit keinem Gedanken mehr an die alten Knochen – und auch an die Champignons.“
Seine Frau lachte ihm dann aufmunternd zu: „Und wenn wir dort sind“, pflegte sie darauf ebenso regelmäßig zu antworten, „sollen unsere Kinder eine richtige Erziehung erhalten und etwas werden, vor dem sich die Bande, unsere Nachbarn, und ihre Gören verstecken müssen.“
Warte nur noch ein bißchen, hatte Carara gesagt, aber das bißchen wurde immer mehr. Irgendwie fügte es sich, daß Cararas Taler sich nicht so rasch vermehrten, als er gehofft hatte. Carara ließ sich die Sache durch den Kopf gehen und fragte sich oft, was zur Abhilfe geschehen könne. Es mußte doch einen Weg geben, den Prozeß des Reichwerdens etwas zu beschleunigen. Die Bank war wohl an allem schuld. Sie zahlte nur schäbige Zinsen für sein Guthaben. Das Konto war schon ganz anständig, aber es warf nicht soviel ab, wie es sollte. Carara hielt dementsprechend Kriegsrat mit Madeline und sie fanden, daß man größere Profite an der Börse erzielen könne. Der Wertpapiermarkt versprach sofortige große Gewinne. So wurde Carara zum Spieler, steckte alles bis auf den letzten Centime in die Spekulation und setzte sich dann mit den Händen in den Schoß hin, um hoffnungsvoll auf das Hereinströmen der erhofften Reichtümer zu warten.
Wie viele andere Spieler sollte auch Carara eine bittere Enttäuschung erleben. Er war für dieses Geschäft weder gerissen, noch erfahren genug und ließ es auch bei der Wahl seines Maklers an Menschenkenntnis bedenklich fehlen. Es war nun einmal kein Mann der großen Welt und hätte besser bei seinen Champignons bleiben sollen.
All diese Dinge hatte Carara, wie später festgestellt wurde, seinem alten Freund Lamarre anvertraut. Lepine gegenüber war er viel schweigsamer. Ihm erzählt er nur einiges über seine Champignonzucht.
„Jawohl“, antwortete er auf eine Frage seines Besuchers, „Lucien Lamarre war mit uns gut befreundet. Er machte immer am Sonnabend bei uns Station, um ein bißchen zu plaudern. Er liebte einen Schluck Wein und hatte die Kinder gern. Immer kniff er sie freundlich in die Wangen und manchmal brachte er ihnen auch ein kleines Geschenk mit.“
„Hat er Ihnen je etwas über seine persönlichen Angelegenheiten anvertraut oder sich darüber geäußert, wie er seine Freizeit verbringt?“
„Ja, mein Herr“, antwortete Carara. „Er war ein einsamer alter Junggeselle ohne Verwandte und er liebte es, hier ein bißchen sitzen zu bleiben und über vergangene Dinge zu schwatzen. Er war früher Soldat und hat mir oft allerlei über seine Dienstzeit erzählt.“
„Niemals etwas von Frauen?“
„Er hat nie von Frauen gesprochen. Allerdings hat er öfters angedeutet, daß er in seinen Jugendjahren eine Liebesaffäre gehabt hat, die unglücklich ausgegangen ist, aber darüber hat er nie Einzelheiten erzählt.“
Lepine schien in das Studium seines Gegenübers versunken. Plötzlich aber wandte er sich an Madeline und fragte:“ Hat einer von euch beiden eine Idee, was Lamarre zugestoßen sein könnte? Halten Sie es für denkbar, daß er mit dem Geld durchgegangen ist?“
Mann und Frau tauschten einen Blick. Keiner antwortete zunächst. Madeline öffnete als erste den Mund.
„Wer kann es sagen? Wenn jemand alt und vom Leben enttäuscht ist, dann tut er bisweilen die seltsamsten Dinge.“
„Ich habe doch Sie etwas gefragt!“ fuhr Lepine den Pilzzüchter an. Der zuckte zusammen:
“Ich“, sagte er, „ich habe mir gar keine Meinung darüber gebildet. Aber ich kann nicht glauben, daß mein alter Freund tot ist.“
„Schön“, meinte Lepine. „Tot oder lebend … hat Lam … haben Sie Lamarre mit Ihrem Vertrauen beehrt?“
Carara schien außer Fassung. Madeline antwortete:
„Er wußte, daß wir mit unserem Schicksal hier nicht zufrieden waren. Wir haben ihm oft erzählt, daß wir Geld zusammensparen, um Paris zu verlassen.
„Nun, das wäre alles, Leute“, erklärte Lepine, winkte seinen Begleiter heran und verließ ohne weiteres Zögern das Grundstück.
„Nun? Was?“ fragte der Wachtmeister.
Ich habe etwas für Sie zu tun“, war die Antwort. „Die Leute hier haben Geld gespart. Sie haben die Absicht, das Land zu verlassen. Sie züchten Champignons. Und soviel ich es beurteilen kann, sind sie nicht so töricht, ihr Geld ungenutzt im Haus herumliegen zu lassen. Gehen Sie in die Stadt und suchen Sie ausfindig zu machen, wo ihr Geld deponiert ist. Stellen Sie auch fest, wie och das Guthaben ist und ob in neuester Zeit etwas dazugekommen ist – zum Beispiel etwa 17.000 Frank. Offen gesagt, ich glaube nicht, daß die beiden so einfältig sein könnten, aber man kann nie wissen.“
Die Aufgabe erwies sich als leicht, und das Resultat als enttäuschend. Schon die zweite Bank,, bei der der Beamte vorsprach, war die richtige. Der Kassierer, ein entgegenkommender junger Mann, brauchte erst gar nicht die Bücher heranziehen, um Bescheid zu geben, legte sie aber dann doch vor, um zu zeigen, daß seine Auskunft auf Wahrheit beruhte. Das Konto der Cararas, das auf den Namen Madelines geführt wurde, war vor vier Wochen aufgelöst worden. Vater Carara war mit einer von Madeline unterzeichneten Vollmacht erschienen und hatte den ganzen Betrag an eine Pariser Maklerfirma überweisen lassen.
Der Wachtmeister ging ans Telefon und setzte Lepine von diesen Tatsachen in Kenntnis. Er war darauf gefaßt, daß seine Mitteilungen von Lepine als große Enttäuschung empfunden werden würden. Zu seiner Verwunderung mußte er aber feststellen, daß sie im Gegenteil seinen Vorgesetzten geradezu elektrisierten.
„Ausgezeichnet! Ausgezeichnet!“ rief er. „Endlich kommen wir doch ein bißchen voran. Wer ist der Makler? Wie ist die Adresse?“
Der Beamte gab Auskunft.
„Gehen Sie sofort hin, ich treffe Sie dort.“
Der Wachtmeister beeilte sich zu gehorchen. Lepine erschien natürlich pünktlich. Der Makler war keineswegs so höflich und entgegenkommend wie der Bankkassierer.
„Es seien bei ihm zu viele Konten“, hieß es, „die Geschäfte seien kompliziert und unübersichtlich. Ein Carara befindet sich überhaupt nicht unter seinen Kunden. Er könnte sich an niemanden dieses Namens erinnern.“
„Hm“, knurrte Lepine, den geschmeidigen Chef des Hauses zornig anstarrend, „Sie scheinen an Gedächtnisschwäche zu leiden, mein Freund. Ich kenne eine ausgezeichnete Kur dagegen. Wir behandeln auf dem Polizeipräsidium nach dieser Methode. Ihr Leiden ist derart akut, daß es wohl besser ist, Sie kommen gleich mit. Erste Hilfe ist hier dringend vonnöten!“
Unruhe und Bestürzung malten sich in den Augen des Maklers. Er schlotterte vor Angst und sein ganzes Benehmen änderte sich gründlich. Allerdings war es Tatsache, wenn er behauptete, Cararas Name befinde sich nicht in seinen Büchern. Er gab aber zu, daß er von Carara Gelder zur Anlage erhalten habe. Einen Versuch, genaueres festzustellen, bezeichnete er als vergebliche Liebesmühe, da das Konto längst wieder gelöscht sei. Dies hatte zur Folge, daß Lepine für die nächsten Stunden die Zügel der Regierung im Maklerbüro an sich riß. Auf seinen Befehl mobilisierte der ihn begleitende Beamte eine kleine kriegsstarke Kompanie von Revisoren und Buchhaltern, die mit bemerkenswerter Fixigkeit aus der Registratur die Aufzeichnungen über Crararas finanzielle Transaktionen zutage förderten. Lepine überflog die ihm unterbreiteten Resultate, und selbst dem Auge eines Unkundigen mußte es auf den ersten Blick klar sein, daß Carara sehr unvorsichtig war. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, schnell reich zu werden und mit einem Schlag große Gewinne zu erzielen und war dabei auch einem großen Risiko nicht aus dem Weg gegangen. Der Makler zuckte die Achseln, als Lepine sich verabschiedete.
„Es ist ja sehr bedauerlich, mein Herr“, sagte er, „aber wir können natürlich nicht umhin, die Aufträge, die man uns erteilt, auch auszuführen.“
„Natürlich“, murmelte Lepine. „Zuerst haben Sie ihn beraten und als er dann nichts weiter einschießen konnte, haben Sie ihn exekutiert. Und ich will Ihnen etwas sagen, mein allzu gewandter, junger Freund. Wenn Sie von dem, was sich hier zugetragen hat, auch nur ein Wörtchen verlauten lassen, werde ich Sie rascher hinter Schloß und Riegel haben, als Sie sich nur träumen lassen.“
Lepine verließ das Haus mit der Gewißheit, daß der Makler reinen Mund halten werde. Nachfragen aufgrund des neuen Informationsmaterials ergaben, daß Carara auf sein Haus und sein Grundstück Hypotheken aufgenommen hatte.
„Endlich!“ seufzte der etwas ermüdete jüngere Beamte, „haben wir etwas Material zusammengebracht. Nun werden Sie wohl Carara verhaften?“
„Menschenskind!“ rief Lepine. „Weswegen denn? Haben Sie Lamarres Leiche in der Tasche? Können Sie nachweisen, daß er überhaupt tot ist? Nein, wir haben sehr wenig. Wir haben etwas, das uns vielleicht als leitendes Motiv für unsere weitere Arbeit nützlich sein kann. Wir haben eine Art von Theorie.“
„Gut. Und wohin gehen wir jetzt?“
„Wir gehen zu der Versicherungsgesellschaft. Aber schärfen Sie sich ein: Die Zeit zum Handeln ist noch nicht gekommen! Ich habe einen möglichen Beweggrund für die Ermordung Lamarres nachgewiesen, noch ehe wir nachgewiesen haben, daß er überhaupt ermordet worden ist. Bis jetzt sind wir im Großen und Ganzen der von der gewöhnlichen Praxis vorgeschriebenen Linie gefolgt. Und nun, mein Lieber, werden wir es mit einem kleinen Taschenspielerkniff versuchen.“
So ging denn die Reise zum Büro der Urban-Versicherungsgesellschaft. Lepine hatte eine kurze Unterredung mit dem Direktor, der sich bereit erklärte, auf Lepines Wunsch die Anwälte der Gesellschaft holen zu lassen. Im Stillen war der Wachtmeister über diese neue Wendung verblüfft. Anscheinend hatte also sein Vorgesetzter nicht nur Carara im Verdacht. Es war vielleicht denkbar, daß der Generalagent der Gesellschaft Lamarre umgebracht und sich das Geld zur privaten Verwendung angeeignet hatte? Oder war vielleicht ein anderer Angestellter der Firma beteiligt? Sobald die Anwälte eingetroffen waren, mußte der Wachtmeister jedoch konstatieren, daß Lepine sich jedenfalls für eine solche Möglichkeit nicht interessierte. Als alle versammelt waren, wurde ein Bote zu den Cararas geschickt. Der Auftrag, mit dem er dort erschien, war harmlos genug. Carara und Madeline wurden lediglich ersucht, dem Büro der Gesellschaft einen Besuch abzustatten.
Lepine hatte mit dem Vertreter der Gesellschaft folgendes vereinbart: Wenn das Paar erschien, sollte ihnen sofort mitgeteilt werden, die Gesellschaft stehe auf dem Standpunkt, daß Lamarre das Geld veruntreut habe und damit geflüchtet sei. Die Gesellschaft lege weniger Wert darauf, Lamarre ausfindig zu machen, als das Geld wieder in ihren Besitz zu bringen. Da Carara ein alter Freund Lamarres sei, habe er vielleicht die Möglichkeit, eine Mitteilung an ihn gelangen zu lasen, des Inhalts, daß eine Verfolgung nicht eingeleitet werde, wenn Lamarre das unterschlagene Geld zurückerstatte.
Weder Lepine, noch sein Untergebener warteten übrigens ab, bis das Ehepaar erschien. Der Besuch verlief selbstverständlich ergebnislos. Carara schwor, er wisse nicht, wo man den Alten erreichen könne, er selbst habe ihn seit der Nacht, wo er verschwunden war, auch nicht mehr zu Gesicht bekommen. Madame Carara sagte dasselbe. Auch ihre Kinder wurden vernommen. Die Anwälte machten ein bißchen den Eindruck, als hätten sie ein Brett vor dem Kopf. Sie stellten die sinnlosesten und törichtesten Fragen. Sogar die Kinder haben sich vielleicht ein wenig darüber gewundert. Vor allem waren die Herren Anwälte anscheinend sehr wenig geneigt, sich von dem Ehepaar sehr bald wieder zu trennen. Die ganze Besprechung war entschieden sehr langweilig. Das war freilich notwendig, wenn Lepine und sein Untergebener das ausführen wollten, was Lepine plante.
Die Idee war einfach genug. Lepine hatte ein Dutzend Gendarmen mobil gemacht und war mit ihnen schleunigst zu dem von Carara bewohnten Besitztum gefahren. Am Boden des Schachtes, der in die Katakomben hinabführte, entdeckten sie als erstes die Überreste eines seit langem ausgebrannten Feuers. Der feuchte Boden war mit einer ganz eigenartigen weißen Asche bedeckt. Ringsum an den Wänden leuchteten im Licht der Polizeilaternen große Stapel menschlicher Gebeine, die so geschichtet und geordnet waren, daß sich die seltsamsten Muster und Ornamente ergaben. In einer Ecke stand eine seltsame Maschine, die bei Lepine ungeheures Interesse erregte. Er betrachtete sie, als ob er sich überhaupt nicht wieder losreißen könne. Es war eine Mühle mit mehreren Gängen. Sie glich in vieler Beziehung einer Fleischmühle, wie man sie beim Schlächter sieht, war aber viel größer.
Die Beamten starrten in den Trichter des Instrumentes. Im Inneren lagen Reste einer pulverförmigen Masse, die Lepine sofort als gemahlene Knochen erkannte. Es waren die Knochen der Toten, die Carara gemahlen hatte, um seine Champignonbeete damit zu düngen. Lepine stocherte mit seinem Spazierstock in den verkohlten Resten des Feuers auf dem Boden herum. Der Boden war feucht und schmierig. Die ganze Szene machte einen so gespenstischen Eindruck, daß der junge Beamte ein Zittern nicht unterdrücken konnte. Aber Lepine setzte gelassen seine Untersuchungen fort. Ihn schien nichts aus der Fassung bringen zu können.
Um seine Erregung vor seinem Vorgesetzten zu verbergen, wanderte der Wachtmeister in den anstoßenden Gängen umher, wo ihn überall grinsende Schädel anstarrten. Plötzlich stieß Lepine einen Ruf der Überraschung aus. Er hatte etwas gefunden.
Als sein Untergebener schleunigst zu ihm zurückkehrte, fand er ihn auf dem Boden knien. Er betrachtete mit großer Sorgfalt eine kleine Metallscheibe, die das Feuer entfärbt und geschwärzt hatte. Gleich darauf fuhr Lepine in die Aschenreste und brachte nach vorsichtigem Herumtasten einen Metallring zum Vorschein, der der Größe nach ungefähr der Scheibe entsprach. Er hielt beide Gegenstände dem Wachtmeister hin.
„Die Deckelstücke einer altmodischen Silberuhr“, stammelte der verblüffte Beamte.
Schweigend hielt ihm Lepine einen anderen Gegenstand unter die Augen, ein Brillengestell. Schließlich fanden sich noch Bruchstücke einer goldenen Kette.
„Endlich ein greifbarer Beweis“, knurrte Lepine.
In dem Schweigen, das seinen Worten folgte, wurde ein unheimliches Geräusch vernehmbar, das ähnlich klang wie ein Röcheln. Lepine lächelte.
„Hier irgendwo scheint eine Quelle zu sprudeln“, sagte er.
Nach kaum einer Minute war sie gefunden. Sie entsprang am Fuß der Seitenwand des einen Hauptkorridors. Lepine bückte sich, tauchte die Hände ins Wasser und fischte mit großer Ausdauer etwa fünf Minuten lang darin herum. Als seine Hände endlich triefend wieder zum Vorschein kamen, sah der ihn begleitende Beamte, daß er etwas gefunden haben mußte. Das Licht der Taschenlampe zeigte zwei massive silberne Ringe.
Jetzt schien es Lepine einzufallen, daß wahrscheinlich binnen kurzem die Familie Carara zurückkehren müsse. Er entwickelte plötzlich eine fieberhafte Lebendigkeit. Ein Gendarm wurde herangerufen. Lepine drückte ihm die Ringe, das Brillengestell und die Reste der Uhrkette in die Hand und befahl:
„Gehen Sie damit schleunigst zu Madame Saupin und fragen sie, ob Sie die Stücke wiedererkennt.“
Nach fünfzehn Minuten kehrte der Gendarm zurück. „Madame Saupin“, so erklärte er atemlos, „behauptet, daß diese Gegenstände Lucien Lamarre gehört haben.“
Lepine seufzte: „Gut! Wir haben so ziemlich alles gefunden, außer der Leiche.“ Und damit drehte er sich zu seinem Adjutanten um.
„Ich fürchte sehr, Wachtmeister, daß wir die Leiche niemals finden werden. Wahrscheinlich dient Lamarre in diesem Augenblick bereits als Dünger für die Pilze.“
„Aber“, rief der junge Mann erregt, „der Fall liegt doch nun klar!“
Lepine nickte zustimmend. Er wickelte die gefundenen Gegenstände in sein Taschentuch und stieg, gefolgt von den übrigen Mitgliedern der Expedition, wieder auf die Oberwelt hinauf. Er entließ die Gendarmen bis auf zwei.
Als Carara, seine Frau und seine drei Kinder aus der Stadt zurückkehrten, fanden sie Lepine mit diesen Gendarmen friedlich auf der windschiefen Veranda vor de Haustür sitzen. Lepine erhob sich und zog grüßend den Hut. Martin Carara fuhr wie von einer Natter gestochen zurück. Madeline, deren Gesicht zu einer Maske erstarrt war und nichts verriet, bemächtigte sich der Kinder und fegte an den Beamten vorbei ins Innere des Hauses. Zitternd stieg Carara die drei stufen hinauf, die zur Veranda führten.
„Carara“, fragte Lepine mit völlig ruhiger Stimme, „Carara, warum haben Sie Ihren Freund Lucien Lamarre ermordet?“
Carara stieß ein lautes Ächzen aus. Sein Gesicht war weiß wie die Asche, die seine Pilzbeete bedeckte.
„Warum – ich – was meinen Sie denn eigentlich?“ stammelte er.
Ohne seine Frage zu beachten, zog Lepine aus seiner Tasche die Metallbruchstücke und die Ringe, breitete das ganze sorgfältig auf seiner Handfläche aus und hielt es dem entsetzt dreinblickenden Carara vor die Augen.
„Großer Gott! Ich bin verloren!“ schrie Carara auf. „Es war das Geld, Herr! Ich war ruiniert!“
Lepine zog ihn ins Haus hinein. Sein Untergebener folgte.
Madame Madeline hatte ihre Kinder ins obere Stockwerk gebracht. Als sie wieder herunterkam, schien sie ganz gefaßt, aber ihr Gesicht war grau.
„Sage nichts, Martin“, warnte sie. „Sie können dir nichts tun.“
„Nein, Madeline“, stöhnte er, „es ist alles vorbei. Ich will reinen Tisch machen und alles erzählen.“
„Das ist vernünftig“, lobte Lepine. „Nun geben Sie uns ihre Darstellung der Sache.“
„Nein, nein, nein“, zeterte die Frau, „die Guillotine ist dir sonst sicher!“
Damit stürzte sie ohnmächtig zu Boden. Eine halbe Stunde später brachte der Polizeiwagen die beiden nach Paris hinein. Der Prozeß Cararas entrollte die Einzelheiten eines der widerwärtigsten Verbrechen, die die Kriminalgeschichte Frankreichs kennt.
Carara macht nicht einmal den Versuch, sich zu verteidigen, weder im juristischen, noch im moralischen Sinne. Dagegen gab er eine dramatische Schilderung des Verbrechens.
An dem verhängnisvollen Sonnabendabend war Lamarre wie gewöhnlich bei den Cararas zu Besuch erschienen. Man hatte ihn eingelassen wie immer, aber was dann mit ihm geschah war die Verwirklichung eines sorgfältig ausgeheckten Anschlags, dessen Einzelheiten Carara bereits seit Wochen mit seiner Frau besprochen hatte. Seltsam ist, wie in jedem Zug die Geldgier der Madame Carara zutage tritt, die sogar ein Tuch, das bei dem Mord mit Blut befleckt worden war, nicht preisgeben wollte.
Der Regen fiel in Strömen, als Lamarre über die Schwelle trat. Das erste, was er bemerkte, war, daß der Teppich entfernt war und daß stattdessen ein zum Teil schon beschmutztes Bettuch den Boden bedeckte.
„Das Wetter“, hatte Madame Madeline ihm erklärt, „bekommt meinen Teppichen so schlecht, daß ich alles tun muß, um sie ein wenig zu schonen. Das Laken da zu ersetzen, ist sehr viel weniger kostspielig. Ziehen Sie Ihre nassen Schuhe aus, ich will sie zum Trocknen ans Feuer stellen. Inzwischen können Sie sich da in den Lehnsessel setzen und sich ausruhen.“
Lamarre, der auf das Tuch getreten war, um den Boden nicht zu beschmutzen, bückte sich, um seine Schuhe aufzuschnüren. Sein Überrock war zurückgeschlagen, und man konnte die Geldtasche an seinem Gürtel sehen. Madeline stellte fest, daß sie dick gefüllt war. Sie brachte ihrem Gast ein Glas Wein, und Lamarre setzte es eben an die Lippen, als Carara zuschlug. Er hatte sich hinter Lamarres Stuhl geschlichen und war mit einer alten Spitzhacke aus dem Steinbruch bewaffnet. Das Mordwerkzeug traf Lamarre mit solcher Wucht auf den Schädel, daß er sofort tot umfiel.
„Und wo waren die Kinder während dieser Zeit?“ fragte der Richter.
„Madeline hatte ihnen etwas Sirup mit einem Schlafmittel eingeflößt und sie lagen die ganze Zeit im oberen Stockwerk in tiefstem Schlummer.“
Dann setzte er seinen Bericht fort. Er löschte überall im Haus das Licht aus. Seine Frau öffnete leise die Küchentür. Dann kam sie zu ihrem Mann zurück. Gemeinsam bemächtigten sie sich nunmehr der Geldtasche Lamarres, dann rollten sie die Leiche, die Mordwaffe und das zerbrochene Weinglas in das Tuch und schleppten ihre furchtbare Last über den Hof zu dem Katakombenschacht, wo sie halt machten. Der Schacht war so eng, daß ein Mensch gerade darin Platz hatte. Carara stieg hinein und stützte sich, auf der obersten Leiter stehend, von unten mit den Schultern gegen sein Opfer, während Madame Carara oben nachhalf und die Last allmählich in das Loch hineingleiten ließ. Den zusammengekrümmten Leichnam auf dem Rücken, stieg dann Carara langsam in den Schacht hinab, während Madeline oben Wache stand. Als ihr Mann glücklich unten angelangt war, beugte sie sich über die Öffnung und rief leise hinab: „Martin, vergiß auch ja nicht das Tuch mitzubringen!“
Ihre Stimme drückte die größte Besorgnis aus. Carara war in dem dunklen Schacht wie zu Hause. Er ließ seine Last neben der Knochenmühle zu Boden gleiten und löste die Knoten. Dann beugte er sich über sein Opfer, leerte ihm die Taschen, riß die Ringe und die Brille ab, zog ihm die Oberkleider herunter und legte den Körper auf einen Holzstoß, den er schon längst vorbereitet hatte. Die Kleidungsstücke, die er dem Toten ausgezogen hatte, warf er oben darüber. Die Uhrkette des Opfers hatte sich an einem Knopf an Cararas Ärmel festgehängt, und als er sich losriß, brach die Kette auseinander. Dann nahm er die beiden Ringe und schleuderte sie in die Quelle.
„Ich war zu aufgeregt“, erklärte er in seiner Aussage darüber, „und ich war daher unfähig, nachzudenken, wo ich die übrigen Gegenstände verbergen könne. Ich dachte auch, das Feuer würde sie zerstören. Ich hatte Angst bekommen und wollte möglichst rasch wieder aus dem Loch heraus sein.“
„Mehrere Tage vorher“, sagte der desweiteren aus, „hatte ich alles ausprobiert und die Luftströmungen in den Katakomben berechnet. Ich hatte mir also den Platz für das Feuer sorgfältig ausgesucht und brauchte nicht zu befürchten, durch eine aus dem Schacht aufsteigende Rauchwolke verraten zu werden.“
Als der Scheiterhaufen in voller Glut stand, waren Carara und seine Frau in ihre Wohnung zurückgekehrt, während der grausige Beweis ihrer Tat vom Feuer verzehrt wurde. Mehrere stunden später kehrten sie an die Schachtöffnung zurück. Carara kletterte hinab, während seine Frau an der Mündung wartete. Zwanzig Minuten vergingen, ohne daß Martin, der allerdings vieles unten zu tun hatte, etwas von sich hören ließ. Madeline wurde besorgt und stieg selbst hinunter.
Sie hatte den Eindruck, daß irgendetwas schief gegangen sein müsse. Unten im Tunnel schlug der Rauch nach rückwärts und stieg im Schacht in die Höhe. Sie mußte sich ihren Weg durch den dichten Qualm erkämpfen, und es dauerte fünf Minuten, ehe sie über Carara strauchelte, der bewußtlos am Boden lag. Er war von den Rauchschwaden betäubt worden.
„Meine Frau“, sagte Carara aus, „schleppte mich zur Leiter. Es gelang ihr tatsächlich, mich nach oben an die frische Luft zu schaffen. Als der Regen mir ins Gesicht schlug, kam ich wieder zu mir. Wir warteten noch mehrere Stunden und kehrten dann in die Katakomben zurück.“
Jetzt kommt vielleicht das Widerwärtigste an dem ganzen Verbrechen. Carara holte Wasser aus der Quelle und löschte damit das niedergebrannte Feuer. Was von Lamarre noch übrig geblieben war, wurde gesammelt und in den Trichter der Knochenmühle gesteckt. Carara drehte die Kurbel. Seine Frau trug den Aschenstaub in die Gänge und verstreute ihn über die Pilzbeete. Dann kehrten beide in ihre Wohnung zurück und schliefen zwölf Stunden.
Von da an hatten sie es nicht mehr gewagt, den Schacht zu betreten. Es graute sie jetzt vor ihrem Verbrechen. Sie hielten sich im Haus eingeschlossen. Hätte ihre Kaltblütigkeit die beiden nicht so plötzlich im Stich gelassen, so hätte Carara wahrscheinlich Vorsorge getroffen, um auch die Beweisstücke zu beseitigen, die Lepine später in den Katakomben fand.
Wahrscheinlich wären die beiden Mörder dann der gerechten Strafe entgangen. So aber machte Carara mit der Guillotine Bekanntschaft, während seine Frau für dreißig Jahre ins Gefängnis wanderte.
Aus: Martin J. Porter: Das unheimliche Rätsel in den Katakomben von Paris. In: Wahre Detektiv Geschichten. 1. Jahrgang. 3. Mai 1930. Nummer 3, S. 3-12.